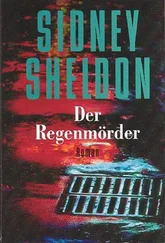Jetzt stand die Babysitterin in der Tür und trat in ihren viel zu warmen Turnschuhen von einem Fuß auf den anderen. Sie trug ein dünnes weißes Baumwollhemd mit einem roten Herzen. Die Kinder hatten schon aufgemacht und drängten sich nun lachend um die Beine des schmächtigen Mädchens; sie fanden es immer wunderbar, einige Stunden mit ihr allein zu sein, da das Mädchen sie, anders als die Eltern und vermutlich aus purer Gleichgültigkeit, auf dem Sofa herumhopsen und im Bett Purzelbäume schlagen ließ, bis ihre Gesichter glühten und ihre Haare schweißnass waren. Henrietta wusste das, wollte die Babysitterin aber nicht zurechtweisen. Wenn man mal jemand Zuverlässigen gefunden hatte, musste man sich alle Mühe geben, ihn zu halten, auch wenn sie den Kindern zu viele Freiheiten erlaubte.
»Komm rein«, sagte Henrietta, trocknete sich an einem Geschirrtuch die Hände ab und ging in die Diele. »Es wird wohl auch heute Abend nichts. Erik ist noch nicht zu Hause, und wenn er in zehn Minuten nicht da ist, dann schaffen wir es nicht mehr.«
Rebecka stand unschlüssig auf der Türschwelle und biss sich auf ihre rosa Lippe.
»Soll ich nach Hause gehen oder ...«
»Warte bitte noch. Man weiß ja nie. Und du wirst auf jeden Fall bezahlt, es ist ja nicht deine Schuld ...«
Nein, es war nicht die Schuld der Kleinen, dass Erik zum x-ten Mal so viel zu spät kam, dass Kinobesuch und Essen sich mal wieder erledigt hatten. »Wir holen das an einem anderen Freitag nach«, hatte Erik beim vorigen Mal gesagt, aber ohne ihr in die Augen zu schauen, und Henrietta schien es, dass er selbst nicht glaubte, was er da sagte. Seine Arbeit fraß immer mehr von den Abenden auf, während Henrietta sich zu Hause um alles kümmerte und die Kinder rechtzeitg ins Bett steckte. Oft kam Erik erst so spät, dass er ihnen nicht einmal mehr gute Nacht sagen konnte. »Wo ist Papa?«, fragten sie manchmal. »Der arbeitet«, antwortete Henrietta dann, und obwohl sie es nicht wollte, hörte sie doch ein gewisses Maß an Bitterkeit in ihrer Stimme mitklingen. Als beiße sie die letzte Silbe des Satzes ab, um sie dann wütend auf den Teppich zu spucken und zu zertrampeln. Als wolle sie auch Eriks Erklärungen und Ausflüchte zertrampeln und sagen, jetzt hör verdammt noch mal auf, so viel zu arbeiten. Ich oder die Arbeit, entscheide dich. Aber so weit kam sie nie, lief nur verärgert hin und her und starrte ihn wütend an. In der Hoffnung, dass er nun endlich begriff.
Ich bin zu nachgiebig, dachte Henrietta, ich zeige nicht, wie mir wirklich zumute ist. Und drückte Rebecka einen Hunderter in die Finger, die anstandshalber protestierte, sich aber sichtlich darüber freute, für gar nichts so viel bezahlt zu bekommen.
»Wir vergessen das für heute Abend«, sagte Henrietta und schaute in die großen, braunen, von zu viel Wimperntusche eingerahmten Augen. »Aber nächste Woche, vielleicht, wenn du dann Zeit hast?«
Rebecka nickte lächelnd, während Henrietta dachte, dass sie sich den letzten Satz hätte sparen können. Sie wusste nur zu gut, dass ihr Mann auch am nächsten und am übernächsten Freitag Überstunden machen würde. Und nur Gott, falls überhaupt, wusste, wie lange das noch so weitergehen würde.
Ab und zu, manchmal, wenn es abends so spät wurde, dass sie fast schon einsam vor dem Fernseher eingeschlafen war, ehe sie seinen Schlüssel im Schloss hörte, hatte sie darüber spekuliert, was er da eigentlich machte. Musste er wirklich arbeiten? Oder hatte er eine andere, war das mit der Arbeit nur ein Deckmäntelchen für etwas, das Henrietta in ihrer Naivität nicht durchschaute? In solchen Momenten schaute sie in den Spiegel und sah dort eine Frau mit viel zu schmalem Gesicht, mit eingefallenen Wangen und gerunzelter Stirn, die so leicht an der Nase herumzuführen war, dass sie jede Lüge schluckte, die ihr vorgelegt wurde. Sollte sie etwas sagen? Immer wieder wirbelten dieselben Fragen durch ihren Kopf, blieben aber zu vage, um wirklich Form anzunehmen. Darüber hinaus war sie sich nicht sicher, dass sie die Folgen der möglichen Antworten tragen wollte.
Also saß sie auch an diesem Abend brav da und wartete. Wenn auch die Wut irgendwo im Hinterkopf auf der Lauer lag. Als Erik Sander um zwanzig nach sechs mit tausend gestammelten Erklärungen und Entschuldigungen in die Diele trat, sah sie ihn kurz an, starr und durchdringend, und machte dann kehrt, ging ins Schlafzimmer der Kinder, sagte, die müssten jetzt ins Bett, hob das Pu der Bär-Buch vom Boden auf, putzte den beiden widerstrebenden Jungen die Zähne und steckte sie ins Bett. Nachdem Erik den Kindern gute Nacht gesagt hatte, fing sie an zu lesen. Die Geschichte von Pu dem Bären im Hundertmorgenwald machte sie ein wenig schläfrig, dämpfte den Zorn, der immer noch in ihr tobte, und versetzte nicht nur die Kinder, sondern auch sie selbst in eine seltsame Ruhe. Es war schon fast halb neun, als sie neben den schlafenden Kindern erwachte, überrascht, weil sie so schnell eingeschlafen war. Sie fühlte sich müde und schlaftrunken, zwang sich aber zum Aufstehen. Vielleicht kam ja etwas im Fernsehen. Als sie zum Sofa ging, war Erik nicht dort, war auch nicht in der Küche. Eine eben erst benutzte Kaffeetasse stand im Spülstein, Sie blickte hinter das Regal, das sie im Wohnzimmer als Raumteiler benutzten, und sah auf dem Bett seine Beine. Er hatte nicht einmal die Tagesdecke weggenommen, so schnell war er eingschlafen. Im Raum herrschte eine bleierne Stille. Viel später, als alles vorüber war, dachte sie, dass an diesem Abend vielleicht alles begonnen hatte, und dass diese Stille die Ursache dafür gewesen sei, dass alles so wurde, wie es eben geworden war.
Auf dem Hof herrschte trübes Dämmerlicht, als Rebecka die Haustür hinter sich ins Schloss fallen ließ. Krach. Es war immer so laut. Was sollte sie jetzt tun? Sie spielte mit dem glatten Hunderter in ihrer Tasche herum. Leicht verdientes Geld, wirklich, auf diese Weise würde sie gern weiterhin bei Henrietta babysitten. Das war doch der pure Traumjob.
Vielleicht sollte sie in die Stadt fahren und sich ein Eis oder einen Hamburger kaufen. Ihre Mutter musste an diesem Abend arbeiten, und dann war sie nie vor zehn zu Hause. Rebecka ging über den Bürgersteig. Überall Pfützen, die Laternen brannten schon, obwohl es doch mitten im Sommer war und der Himmel eigentlich hell sein müsste. Das Licht der Laternen spiegelte sich im Regenwasser wider, und der Asphalt sah schwärzer aus als sonst. Es gluckste unter ihren Schuhen.
Plötzlich war sie da, die Katze. Ein mageres schwarzes Tier mit großen grünen Augen, die ebenso funkelten wie die Pfützen.
Rebecka bückte sich.
»Aber hallo, Miezekätzchen«, sagte sie. »Was machst du denn hier?«
Die Katze rieb ihre Nase an Rebeckas Bein. Rebecka streichelte ihren Rücken und spürte durch das Fell die Rippen.
Sie hob das Tier hoch. Leicht wie eine Tüte Zucker. Bereitwillig ließ die Katze sich in den Arm nehmen und fing an zu schnurren. Wie eine leise tickende Uhr, fand Rebecka.
Als Rebecka die Katze dann auf den Boden setzte, um weiterzugehen, folgte das Tier ihr. Bis zur Bushaltestelle und dann wieder zurück. Denn nachdem sie eine Viertelstunde im Regen auf den Bus gewartet hatte, der sich offensichtlich verspätete, hatte sie keine Lust mehr, in die Stadt zu fahren. Schließlich war ihre Mutter nicht zu Hause, und das hieß, sie hatte die Wohnung für sich. Sie beschloss, in den Lebensmittelladen an der Ecke zu gehen und sich eine Tüte Chips zu kaufen.
»Aber hier kannst du nicht mitkommen«, sagte Rebecka, als die Katze versuchte, ihr in den Laden zu folgen.
Sie beeilte sich, nahm auch noch einen halben Liter Birnenlimonade mit, wo sie schon einmal da war. Geld hatte sie ja schließlich mehr als genug.
Als sie aus dem Laden kam, war die Katze verschwunden. Rebecka lief über den Rasen. Summte vor sich hin. Spielte mit dem Gedanken, Anders anzurufen, konnte sich aber nicht dazu durchringen.
Читать дальше