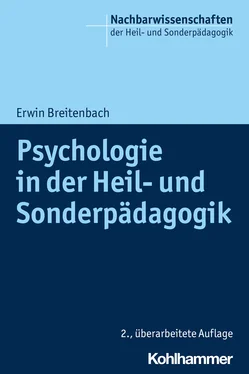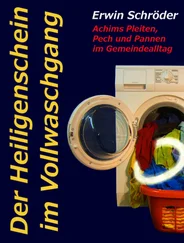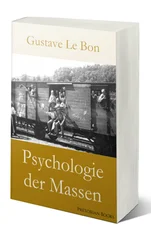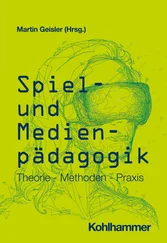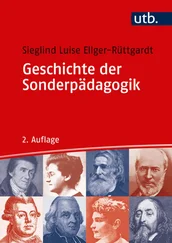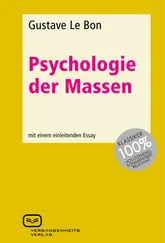Schuck (2004a) berichtet über die mangelhafte Qualität von Noten zur Bewertung von Lernprozessen und zur Begründung von Übergangsempfehlungen und konstatiert aufgrund der vorliegenden empirischen Befunde, dass die Schulnoten, denen im gegliederten Schulsystem die systemnotwendige Selektionsfunktion zukommt, aufgrund der empirischen Datenlage, eigentlich längst hätten abgeschafft werden müssen. Ergebnisse aus der IGLU-Studie offenbaren anhand der geringen Korrelation zwischen Lesenote und erreichter Lesekompetenzstufe, wie mäßig die Lesenote als Kennzeichnung eines Lernprozessergebnisses taugt.
Ähnlich kritisch äußert sich Schuck (2004a) zur Brauchbarkeit von Schulnoten beim Aussprechen von Übergangsempfehlungen in die Sekundarstufe und damit zur Gestaltung des weiteren schulischen Werdegangs, indem er auf Untersuchungen rekurriert, die wiederum die Leseleistung von Kindern am Ende der vierten Klasse mit deren Empfehlungen zum Übergang an die Haupt-, Realschule bzw. ans Gymnasium in Beziehung setzen. Dabei zeigt sich eine Überlappung der Leseleistungen der Hauptschul- und Gymnasiumsempfohlenen in einem Bereich von zwei Kompetenzstufen oder von 200 Punkten bei einer Skalenlänge von 450 Punkten. »Wer ist in diesem Überlappungsbereich eigentlich Gymnasiast oder Hauptschüler? Schreit ein solches Ergebnis nicht nach mehr Gerechtigkeit, nach mehr Präzision der Diagnostik und besser qualifizierten Diagnostikerinnen und Diagnostikern« (Schuck 2004a, 352)?
Die Reihe entsprechender Befunde, die über die Untauglichkeit bisheriger Selektions- und Platzierungsdiagnostik vor allem im schulischen Bereich berichten, ließe sich fast beliebig fortsetzen und verweist nur auf die dringende Forderung nach qualitativ besseren Instrumenten und Verfahrensweisen.
Gerade wegen ihrer Bedeutsamkeit für weitreichende Entscheidungen im Leben von Menschen mit und ohne Behinderungen muss auch auf die vorhandenen Probleme und Begrenzungen im Zusammenhang mit der Selektions- und Platzierungsdiagnostik aufmerksam gemacht werden.
Die Qualität einer Selektions- und Platzierungsdiagnostik und die auf ihr beruhenden Entscheidungen hängen zu großen Teilen von der Klarheit, der Genauigkeit und Vollständigkeit der zugrunde gelegten Anforderungsprofile und Kategorien ab. Ungeklärt bleiben dort meist Fragen, ob die Anforderungen im Profil gleichwertig nebeneinanderstehen oder hierarchisch zu werten sind oder ob jede einzelne Anforderung unabdingbar ist oder ob nicht bestimmte Anforderungen wechselseitig kompensierbar sind oder einfach, in welchem Ausmaß die einzelnen Anforderungen gegeben sein müssen.
Mit der Unklarheit in den Anforderungsprofilen geht oft auch eine Unklarheit bei den verwendeten Begriffen und Kategorien einher. Beredtes Beispiel für dieses Problem sind die steigenden Gesamtquoten für Menschen mit Behinderungen und die höchst unterschiedlichen Anteile der einzelnen Förderschwerpunkte zwischen den Bundesländern, aber auch innerhalb der Bundesländer. Der Anteil aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland ist seit 1950 von 1,3 Prozent auf 6,2 Prozent im Jahr 2010 gestiegen (Preuss-Lausitz 2010; Klemm & Preuss-Lausitz 2011) und die Differenzen in den Förderschwerpunkten zwischen den Bundesländern schwanken zwischen dem Doppelten und dem Siebenfachen (Klemm & Preuss-Lausitz 2008; 2011). Wer also zu einem Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf wird, ist selbst bei den vermeintlich eindeutig gefassten Behinderungsschwerpunkten höchst strittig und es fehlen noch immer trotz KMK-Empfehlungen und Prüfung der entsprechenden Gutachten durch die Schulaufsicht klare und einheitliche Standards.
Der bevorzugte Einsatz psychometrischer Verfahren im Rahmen der Selektions- und Platzierungsdiagnostik speziell in sonderpädagogischen Arbeitsfeldern ist für Trost (2008) mit einigen beachtenswerten Problemen behaftet. So ist die Interaktion zwischen Diagnostiker und Proband durch die Standardisierung erheblich eingeschränkt, was in sonderpädagogischen Zusammenhängen oft nachteilig wirkt, weil hier immer wieder über die Standardisierung hinausgehende zusätzliche Hinweise, Verdeutlichungen, Erläuterungen, Ermutigungen oder Unterbrechungen erforderlich sind, will man ein aussagekräftiges Untersuchungsergebnis erhalten. Des Weiteren wird durch die individuumzentrierte Perspektive die Verantwortlichkeit für ein Testergebnis, eine Testleistung allein ins Kind verlagert. Kontextvariablen, die ebenfalls ein Ergebnis mitbestimmen, bleiben aufgrund des Objektivierungsgebotes mithilfe der Standardisierung weitgehend unberücksichtigt. Ursachen werden kaum aufgedeckt, da psychologische Tests in erster Linie Aussagen über das Vorhandensein und nicht über das Zustandekommen machen. Auch ist ein Zahlenwert als Ergebnis eine dürre und recht ungeeignete Beschreibung einer Lebens- und Lernsituation. Darüber hinaus stellt die Logik der Defizit- und Problemorientierung ein weiteres Problem dar, indem sie Verhaltensauffälligkeiten ausschließlich als Normabweichung und als problematisches Verhalten interpretiert. Was aber als Pathologie oder Störung erscheint, kann ein subjektiv sinnvolles und in einer bestimmten Lebenssituation gut angepasstes Verhalten sein, was als eigenaktiver Beitrag zur Problembewältigung bei Förderung und Intervention zu berücksichtigen wäre.
Als Ergebnis eigener Untersuchungen berichtet Schuck (2004a) über die immer noch vorhandene Dominanz der Intelligenztestverfahren in den sonderpädagogischen Gutachten, mit deren Hilfe vor allem die Frage nach der Platzierung beantwortet und begründet wird. Die mutmaßlichen Ursachen für Schulversagen werden also vorwiegend im kognitiven Leistungsvermögen gesucht, worin für Schuck (2004a) eine entwicklungspsychologisch überholte Vorstellung zum Ausdruck kommt, dass Menschen der inneren Bedingung Intelligenz gewissermaßen ausgeliefert sind. Dieser Glaube an die determinierende Kraft kognitiver Leistungen ist mit vorliegenden empirischen Daten nicht vereinbar, wonach z. B. zwischen Intelligenz und Rechtschreib- bzw. Leseleistung äußerst geringe Korrelationen bestehen. So konnten in der IGLU-Studie 55,5 Prozent der Kinder mit einem Intelligenzquotienten von weniger als 85 die Kompetenzstufen von zwei bis vier erreichen und 11,5 Prozent dieser Kinder sogar noch die höchste Kompetenzstufe. »Diese empirischen Ergebnisse deklassieren eine pädagogische Strategie, die ein niedriges Intelligenztestergebnis zum Kriterium für die Auswahl von schulischen Anforderungsniveaus macht, auf dieser Grundlage Schulentscheidungen trifft und damit Lebenschancen verteilt« (Schuck 2004a, 351 f.).
Die Platzierungs- und Selektionsdiagnostik folgt der Logik einer norm- und kriteriumsorientierten Statusdiagnostik und bedient sich methodisch in erster Linie psychometrischer Verfahren, um den Status einer Person in unterschiedlichen Leistungs- und Persönlichkeitsbereichen zu erfassen. Sie umfasst Inhalte und Aufgaben der Leistungs-, Entwicklungs-, Eignungs- und Persönlichkeitsdiagnostik.
Sie kann im sonderpädagogischen Handlungsfeld als eine Diagnose vor der Diagnostik bezeichnet werden, die zunächst sonderpädagogischen Handlungsbedarf feststellt und damit Zuweisungen und Platzierung veranlasst und begründet, um dann im zweiten Schritt notwendigerweise von einer den Förderbedarf und die Fördermaßnahme näher bestimmenden Förderdiagnose ergänzt zu werden.
Gerade wegen der großen Bedeutung dieser Erstdiagnosen für die Zuweisung von Ressourcen und die Verteilung von Lebenschancen, was im schulischen Bereich mithilfe von Noten, Gutachten und Empfehlungen durch Lehrkräfte nur äußerst mangelhaft gelingt, müssen dem Diagnostiker wichtige Probleme und Begrenzungen der Situations- und Platzierungsdiagnostik bewusst sein, um die mit ihr verbundenen weitreichenden Entscheidungen verantwortungsbewusst und professionell vorzubereiten.
Читать дальше