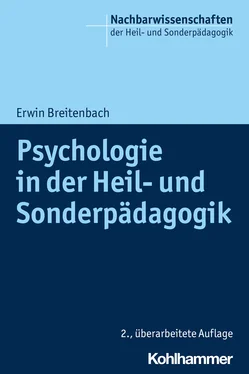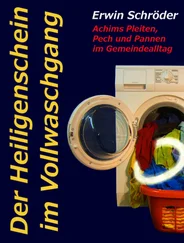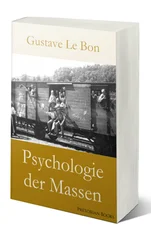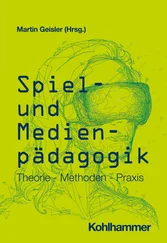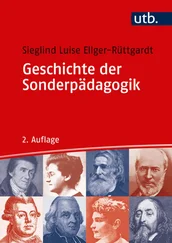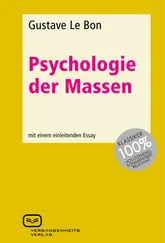Trotz grundlegender theoretischer Mängel und fehlender empirischer Validität fand das Konzept der Förderdiagnostik in der Sonderpädagogik eine weite Verbreitung. Immer wieder wurde versucht, das Charakteristische und Typische der Förderdiagnostik herauszuarbeiten, ohne dass eine zufriedenstellende Abgrenzung jedoch bisher gelungen wäre. Dennoch lassen sich in der einschlägigen Fachliteratur Bestimmungsstücke ausmachen, die von vielen Autoren mit dem Konzept der Förderdiagnostik in Verbindung gebracht werden und die offensichtlich für das sonderpädagogische Denken und Handeln zentrale Aspekte zum Ausdruck bringen:
• Förderdiagnostik analysiert Lernprozesse und stellt unter Zuhilfenahme von struktur- und entwicklungsorientierten Bezugstheorien fest, wie weit ein Lernender bereits in das zu Lernende eingedrungen ist und welche nächsten Lernschritte mit welchen Hilfestellungen zu gehen sind. Eine solide theoretische Grundlegung für dieses Durchschreiten der Zone der proximalen Entwicklung findet sich in der entwicklungspsychologischen Theorie von Wygotski (2002).
• Förderdiagnostik geht davon aus, dass jegliches Verhalten kontextabhängig ist und bezieht deshalb das gesamte Umfeld in die Analyse mit ein. Als problematisch vor allem in der Praxis erweist sich jedoch das Bestimmen relevanter spezifischer Umweltbedingungen im Zusammenhang mit bestimmten Verhaltens- und Erlebensweisen. Kurt Lewin (1969) beschreibt in seinem Konzept des Lebensraumes, der ein psychologisch-funktionaler ist, wie eine nähere Beschreibung dessen, was im konkreten Fall unter Situation und Umfeld zu verstehen ist, durch die Übernahme der Perspektive der Lernenden gelingen kann.
• Die konsequente Verknüpfung von Diagnose und Förderung ist nicht zu verstehen als direktes Ableiten der Förderziele aus vorliegenden diagnostischen Daten, sondern als das Erfassen der Lernausgangslage, die zusammen mit Theorien über Lernen, über Entwicklungsverläufe und Störungsbilder sowie über entsprechende Präventions- und Interventionskonzepte den Förderdiagnostiker in die Lage versetzt, Hypothesen zur Beschreibung förderlicher und hemmender Entwicklungs- und Lernbedingungen aufzustellen, nächste Förderziele und mögliche Maßnahmen zum Erreichen dieser Ziele zu benennen. Förderdiagnostik ist ein zyklischer hypothesengenerierender und hypothesenprüfender Prozess, der seinen Ausgang in einer Bestandsaufnahme nimmt, um ein Förderkonzept und einen Förderplan zu entwickeln sowie dessen Umsetzung zu begleiten und zu evaluieren.
• Förderdiagnostik muss somit immer pädagogischen, didaktischen und psychologischen Theorien nachgeordnet gedacht werden. Nur mit Bezugnahme auf solche vorgeordneten Theorien ist es möglich, im Verlauf des förderdiagnostischen Prozesses vorliegende Lernprobleme zu verstehen und weiterführende Fördermöglichkeiten zu finden.
• Förderdiagnostik erfasst und berücksichtigt gleichermaßen Stärken und Schwächen, da sich beide gegenseitig bedingen und gemeinsam die Individualität einer Person ausmachen. Förderdiagnostisch aussagekräftige Informationen ergeben sich an dem Punkt, wo Können in Nicht-Können übergeht. Stärken erhalten dann eine besondere Bedeutung, wenn sie als Kompensationsmöglichkeiten zur Bewältigung spezifischer Situationen eingesetzt werden können.
Die Förderdiagnostik ist als Modifikationsstrategie in Abhebung zur Selektions- oder Platzierungsdiagnostik zu verstehen.
5 Selektions- oder Platzierungsdiagnostik
5.1 Inhalte und Aufgaben
Fragen der Selektion und Platzierung, die der Logik einer normorientierten, klassifizierenden und taxonomischen Statusdiagnostik folgen, sollen nach Kany und Schöler (2009) zu Informationen darüber führen,
• ob ein Kind altersgemäß entwickelt ist,
• ob die Entwicklung synchron verläuft, d. h., ob Leistungs-, Persönlichkeits- sowie sozialemotionale Entwicklung im Einklang verlaufen,
• ob ein Verdacht auf eine Störung in einem der Entwicklungsbereiche vorliegt und
• wie die Aussichten für die weitere Entwicklung sind.
Erfasst wird der aktuelle Status einer Person in verschiedenen Leistungs- und Persönlichkeitsbereichen, indem man sich, so Trost (2008), methodisch vor allem auf psychologisches Tests oder andere standardisierte psychometrische Verfahren stützt, die dann auch die gewünschten inter- und intraindividuellen Vergleiche zulassen.
Die Leistungsdiagnostik ist nach wie vor durch die Intelligenztests geprägt, obwohl mittlerweile auch spezielle Leistungstest z. B. zur Messung der Aufmerksamkeit und Konzentration oder unterschiedlicher Gedächtnisfunktionen existieren.
Ebenfalls zur Leistungsdiagnostik zählen nach Kubinger (2009) die Entwicklungs- und Eignungsdiagnostik mit entsprechenden psychometrischen Verfahren. Entwicklungstests bilden eine Untergruppe der Leistungstests, die sich auf das Säuglings-, Kleinkind- oder Vorschulalter beziehen und entwicklungsrelevante Bereiche wie Lernen und Gedächtnis, visuelle Wahrnehmung, Sprache, Motorik usw. erfassen. Eignungstests bestimmen die Fähigkeiten und die Motivation einer Person, bestimmten beruflichen oder ausbildungsbezogenen Anforderungen und Erwartungen zu genügen. Für Kubinger (2009) geht es auch darum, ob der zur Diskussion stehende Ausbildungsweg bzw. Beruf den Bedürfnissen und der Lebensorientierung der Person entspricht.
Im Unterschied zur Leistungsdiagnostik, wo der Proband ein Zielmerkmal realisieren soll und seine Antwort richtig oder falsch sein kann, wird in der Persönlichkeitsdiagnostik das Zielmerkmal beschrieben und festgestellt, ob es vorhanden ist oder nicht oder in welcher Qualität oder in welchem Ausmaß es vorhanden ist. Wenngleich auch Intelligenz und andere Leistungsbereiche Teile der Persönlichkeit sind, zählen sie nicht zu den Kategorien der Persönlichkeitsdiagnostik. Persönlichkeitstests erfassen überdauernde Persönlichkeitseigenschaften oder -merkmale, in denen sich Menschen unterscheiden. Dabei bezieht man sich heutzutage nach Meinung von Kubinger (2009) auf das Persönlichkeitsmodell der »Big-Five«, in dem angenommen wird, dass sich Menschen wesentlich hinsichtlich der Faktoren Neurotizismus oder emotionale Stabilität, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit unterscheiden.
5.2 Diagnose vor der Diagnostik
Gerade in der sonderpädagogischen Praxis begegnet uns immer wieder eine quasi zweistufige diagnostische Fragestellung: zunächst die institutionelle Fragestellung nach Ein- und Umschulung, Zuweisung oder nach dem sonderpädagogischen Förderbedarf und anschließend nach erfolgter Platzierung die förderdiagnostische, erziehungs- und unterrichtsbegleitende Fragestellung, die auf verursachende und aufrechterhaltende Bedingungen für Lern- und Entwicklungsprobleme und auf diesbezügliche Fördermöglichkeiten abhebt (Arnold 2007; Kany & Schöler 2009; Trost 2008). Die Diagnose vor der Diagnostik geht der Frage nach, inwieweit ein sonderpädagogischer Handlungsbedarf gegeben ist, ob eine besondere sonderpädagogische Intervention, Förderung, Therapie oder gar eine Einweisung in eine bestimmte Institution angezeigt sind. Sie ist vor allem für administrative Entscheidungen und für die Kostenübernahme z. B. therapeutischer Hilfen und Interventionen notwendig.
Eine Diagnostik, die Fragen der Selektion und Platzierung aufgreift und beantwortet, wird, so Trost (2008), von vielen Befürwortern der Förderdiagnostik als eine rückständige und anstößige Form der sonderpädagogischen Diagnostik angesehen, da sie ein segregierendes Schul- und Ausbildungssystem stabilisiere und integrative Modelle verhindere. Dies ist für Trost (2008) jedoch ein denkbar unglücklicher Standpunkt, »denn im sonderpädagogischen Handlungsfeld sind de facto institutionelle Fragestellungen zu beantworten und es zählt zu den selbstverständlichen Aufgaben sonderpädagogischer Diagnostik, sich mit aller Sorgfalt und Parteilichkeit für die betroffenen Menschen mit Behinderung an der bestmöglichen Absicherung institutionsbezogener Entscheidungen zu beteiligen« (Trost 2008, 170).
Читать дальше