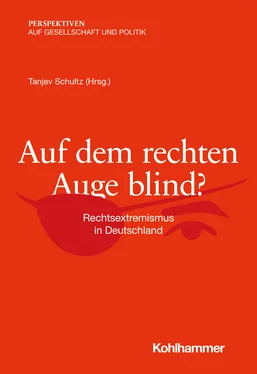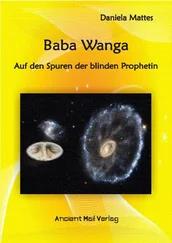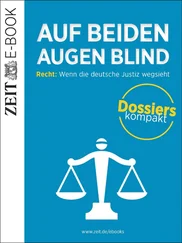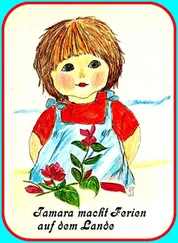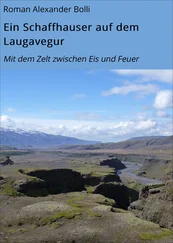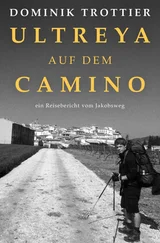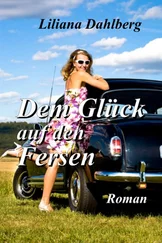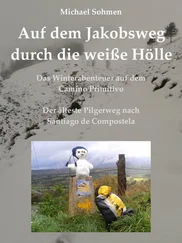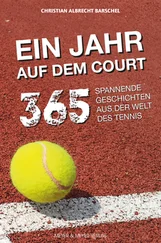Die beiden Vorgeschichten wirkten also zusammen und verstärkten einander, als nach der Vereinigung die bis dahin größten Wellen rassistischer Gewalt über das Land gingen: »Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!« – das wurde jetzt während der pogromartigen Ausschreitungen gegen »Asylanten« oder ehemalige »Vertragsarbeiter« geschrien: in Hoyerswerda im September 1991 oder in Rostock-Lichtenhagen im August 1992. Diesen ebenso radikalen wie komplexen Gewaltereignissen ist – ganz abgesehen davon, dass sie sich auch in Westdeutschland ereigneten, nicht nur in Mölln und Solingen, sondern an vielen Orten – mit einseitigen Erklärungen kaum beizukommen: etwa mit dem Hinweis auf eine vermeintlich genuin ostdeutsche »Fremdenfeindlichkeit« oder auf die Transformationskrise. Verstehen lässt sich diese Gewaltgeschichte nur, wenn man sie im Kontext ihrer deutsch-deutschen Genese vor 1989/90 verortet. Was sich hier äußerte, war ein »Vereinigungsrassismus« im doppelten Sinne des Wortes: weil zusammenkam, was sich vor 1989 in beiden deutschen Staaten entwickelt hatte, und weil die krisenhafte Transformation diesen Prozess dramatisch beschleunigte.
Die hitzige Asyl-Debatte der achtziger Jahre wurde jetzt, zusammen mit der besser organisierten rechtsextremen Szene, in einen aufnahmebereiten Osten exportiert – ein Vereinigungsprozess, über den wir noch viel zu wenig wissen. In Rostock-Lichtenhagen beispielsweise machten just Rechtsextreme aus Hamburg mobil; Michael Andrejewski etwa hatte 1982, zwei Jahre nach dem genannten Brandanschlag auf das Flüchtlingsheim, die Hamburger Liste Ausländerstopp gegründet. Nun deckte er die Rostocker Neubauviertel mit Flugblättern ein, die zum Widerstand gegen die Ausländerflut aufriefen. Diese im Westen erprobten Mobilisierungsstrategien trafen auf eine Kultur des Protests von unten, die sich im Osten schon vor 1989 zu einer gängigen Praxis entwickelt hatte. Jetzt richtete sich der Hass nicht nur gegen die ehemaligen Vertragsarbeitenden aus Vietnam (oder Mosambik), von denen viele bereits entlassen und in ihre Länder zurückgekehrt waren, sondern auch gegen osteuropäische Asylbewerber, darunter häufig Roma. Deren Diskriminierung beruhte auf anderen, über Jahrhunderte hinweg kultivierten rassistischen Vorurteilsstrukturen gegenüber »Zigeunern«.
Anfang der neunziger Jahre diente der rassistische Nationalismus als Kompensation für den Orientierungs- und Statusverlust, der kursierende Diskurs über »Scheinasylanten« und »Wirtschaftsflüchtlinge« re-aktualisierte und radikalisierte Konkurrenzgefühle und Verteilkonflikte. Zudem ermöglichte das politische Vakuum Formen der Selbstjustiz und öffnete Räume für die Entfaltung rechter Gewalt, die es im Westen zwar ebenso, aber doch eingeschränkter gab. Stellvertretend dafür stehen die Bilder applaudierender Nachbarn in Rostock-Lichtenhagen; sie machten den »nachbarschaftlichen Rassismus« und Versuche konsensfähig, das Problem auf dem Weg der Selbstjustiz zu lösen (Jentsch 2016, S. 64).
Die Vorgeschichte nationalistischer und rassistischer (Selbst-)Mobilisierung vor allem in den achtziger und Anfang der neunziger Jahre spielte in den Diskussionen seit 2015 nur eine marginale Rolle, obwohl sich aus der Beschäftigung mit ihr viel lernen ließe. Sie detailliert zu untersuchen und zu schreiben, verspricht Erkenntnisse über Traditionen und Formen der Mobilisierung von rechts in Bundesrepublik und DDR sowie im vereinigten Deutschland, die etwa die stereotype Rede vom »rechten Osten« herausfordern und neue Perspektiven auf ein Thema gewähren können, das uns seit mindestens vier Jahrzehnten erschreckend getreulich begleitet. Die lange deutsch-deutsche Vorgeschichte der gegenwärtigen Konjunktur von Rassismus und rechter Gewalt weist aber auch darauf, wie viel sich in den letzten Jahrzehnten zum Guten verändert hat. Nicht nur haben sich die oft zunächst informellen und lockeren Netzwerke einer demokratischen Gegenmobilisierung professionalisiert und institutionalisiert, wir verfügen zudem über eine stabile sozialwissenschaftliche wie journalistische Expertise, die in den nächsten Jahren um zeithistorische Überlegungen erweitert werden sollte.
Adorno, Theodor W. (1959/1963): Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit. In: Ders., Eingriffe. Neun kritische Modelle. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 125–146.
Adorno, Theodor W. (2019): Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Bösch, Frank (2019): Zeitenwende 1979. Als die Welt von heute begann. München: C.H. Beck.
Botsch, Gideon (2017): Wahre Demokratie und Volksgemeinschaft. Ideologie und Programmatik der NPD und ihres rechtsextremen Umfelds. Wiesbaden: Springer VS.
Dennis, Mike (2005): Die vietnamesischen Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen in der DDR 1980–1989. In: Karin Weiss, ders. (Hrsg.), Erfolg in der Nische? Die Vietnamesen in der DDR und in Ostdeutschland. Münster: Lit, S. 15–50.
El-Mafaalani, Aladin (2018): Das Integrationsparadox. Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt. Köln: KiWi.
Frei, Norbert; Maubach, Franka; Morina, Christina; Tändler, Maik (2019): Zur rechten Zeit. Wider die Rückkehr des Nationalismus. Berlin: Ullstein.
Jentsch, Ulli (2016): Im »Rassenkrieg«. Von der Nationalsozialistischen Bewegung zum NS-Untergrund. In: Heike Kleffner, Anna Spangenberg (Hrsg.), Generation Hoyerswerda. Das Netzwerk militanter Neonazis in Brandenburg. Berlin: Bebra, S. 62–71.
Maubach, Franka (2020): Konjunkturen der Mobilisierung von rechts. Versuch einer zeithistorischen Einordnung. In: Wissen schafft Demokratie (Schriftenreihe des IDZ), Bd. 7: Kontinuitäten. Jena: IDZ, S. 127–135.
Möhring, Maren (2013): Anders essen in der Bundesrepublik: Begegnungen im ausländischen Spezialitätenrestaurant. In: Gabriele Metzler (Hrsg.), Das Andere denken. Repräsentationen von Migration in Westeuropa und den USA im 20. Jahrhundert. Frankfurt/M.: Campus, S. 283–299.
Möhring, Maren (2015): Mobilität und Migration in und zwischen Ost und West. In: Frank Bösch (Hrsg.), Geteilte Geschichte. Ost- und Westdeutschland (1970–2000). Göttingen: V&R, S. 369–410.
Müller, Yves (2019): »Normalfall« Neonazi – oder: Gibt es eine zeithistorische Rechtsextremismus-Forschung? In: Zeitgeschichte-online, 23.10., online unter: https://zeitgeschichte-online.de/themen/normalfall-neonazi-oder-gibt-es-eine-zeithistorische-rechtsextremismus-forschung[zuletzt abgerufen 8.11.2020]
Poutrus, Patrice G. (2016): Aufnahme in die »geschlossene Gesellschaft«. Remigranten, Übersiedler, ausländische Studierende und Arbeitsmigranten in der DDR. In: Jochen Oltmer (Hrsg.), Handbuch Staat und Migration in Deutschland seit dem 17. Jahrhundert. Berlin: De Gruyter, S. 967–995.
Weinke, Annette (2020): Ost, West und der Rest. Die deutsche Einheit als transnationale Verflechtungsgeschichte. In: Marcus Böick, Constantin Goschler, Ralph Jessen (Hrsg.), Jahrbuch Deutsche Einheit 2020. Berlin: Ch. Links, S. 120–144.
Zwengel, Almut (2011): Algerische Vertragsarbeiter in der DDR. Doppelter Sozialstatus, späte Adoleszenz und Protest. In: Dies. (Hrsg.), Die »Gastarbeiter« der DDR. Politischer Kontext und Lebenswelt. Berlin: Lit.
1Der Text basiert, stark verändert, auf Maubach (2020).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.