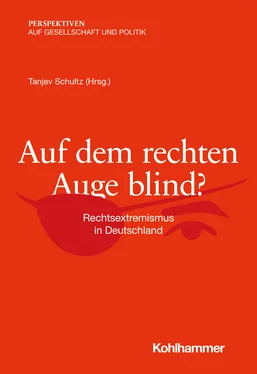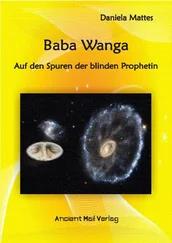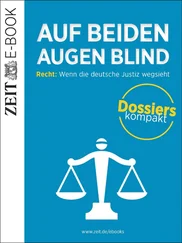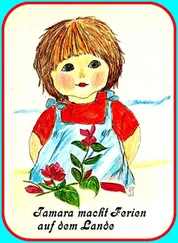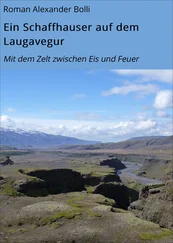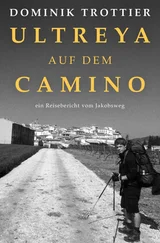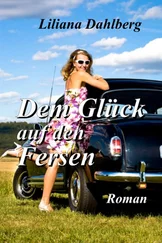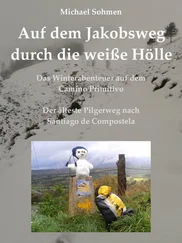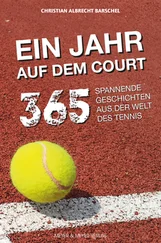Formierung. Mobilisierung von rechts (um 1968)
Die Formierungsphase eines radikalen Nationalismus innerhalb des bundesdeutschen demokratischen Systems liegt in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre. Die Nationaldemokraten (NPD) hatten sich als Sammlungsbewegung gegründet, die nationalkonservativen und rechtsradikalen Gruppen eine gemeinsame politische Heimat bieten, sich von neonazistischen Parteigründungen abgrenzen und so breitere Bevölkerungskreise erreichen wollte. »Deutschland den Deutschen«, dieser mit dem Zusatz »Ausländer raus!« nach der Vereinigung so oft geschriene Slogan, hat seinen Ursprung in dieser Zeit. »Deutschland den Deutschen – Europa den Europäern« war 1964 das Manifest der Partei überschrieben. Damit protestierte die NPD gegen die »Fremdherrschaft« der Besatzungsmächte, gegen Reeducation und den vermeintlichen Zwang zu Wiedergutmachung und Entschädigung.
Tatsächlich gelang der NPD eine bis dahin vergleichslose Breitenwirkung: Bei den Landtagswahlen konnte sie hohe Stimmgewinne verzeichnen, 1968 erreichte sie in Baden-Württemberg mit 9,8 Prozent ihr bestes Ergebnis. Zwar scheiterte sie bei der Bundestagswahl 1969 mit 4,3 Prozent knapp an der Fünf-Prozent-Hürde, bis 2017 aber kam keine Partei rechts von der Union dem Einzug in den Bundestag näher. Dass das gelang, lag an einer Gemengelage von Faktoren.
Erstens erlebte die Bundesrepublik 1966/67 eine erste, wenngleich noch recht harmlose ökonomische Flaute, die der Bevölkerung gleichwohl zu Bewusstsein brachte, dass stetes Wirtschaftswachstum kein Naturgesetz war. Seitdem und bis heute ist die Instrumentalisierung wirtschaftlicher Abstiegsängste ein wesentliches Erfolgsrezept rechter Politik.
Zweitens gingen CDU/CSU und SPD erstmals eine große Koalition auf Bundesebene ein, der vormalige baden-württembergische Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger wurde deren Kanzler (und von rechtskonservativen Wählern und Wählerinnen im »Ländle« sicher auch dafür abgestraft). Die Große Koalition wie die weitere Volksparteiwerdung der CDU ließen Raum für die politische Mobilisierung von rechts. Hinzu kam eine Wahlkampfstrategie, die dicht an den Menschen blieb und dort Präsenz zeigte, wohin die etablierten Parteien sich nicht (mehr) verirrten: in die ländlichen Räume, wo die NPD wirksam Wahlwerbung an Haustüren und in Kneipen machte.
Drittens riefen der politische Wandel, die gesellschaftliche Liberalisierung und die Entwicklung einer linken Jugend- und Protestkultur mehr oder weniger radikale Gegenreaktionen hervor.
Die ersten breiteren Mobilisierungserfolge gründen also in einer Mischung von ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen und Krisenerfahrungen seit Mitte/Ende der sechziger Jahre. Dabei passte sich die Rechte auf ambivalente Weise an die bundesdeutsche Nachkriegsdemokratie an, indem sie sich zunehmend als deren immanente Opposition und bessere Alternative gerierte. In diesem Prozess versuchte die NPD, Traditionslinien zum Nationalsozialismus strategisch zu kappen und neonationalsozialistische Gruppen in ihren Reihen gleichzeitig auszuschließen und zu integrieren – eine widersprüchliche Strategie, die die AfD noch heute verfolgt. Es sei eine »Grundsatzentscheidung der NPD« gewesen, »zugleich als legale Partei und als Fundamentalopposition aufzutreten« (Botsch 2017, S. 69). Für den Erfolg in der Breite der Bevölkerung war dieser strategisch-taktische, aber auch ideologische Anpassungsprozess eine wesentliche Voraussetzung; von ihm profitiert der radikale Nationalismus bis heute. Noch viel ausgeprägter als die NPD stilisiert sich die AfD als Kraft des Widerstands gegen die vermeintliche »Diktatur« der »Altparteien« und als erste Vertreterin einer »wahren Demokratie«.
Zwar formierte sich in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre eine rechtsradikale Opposition im demokratischen System; als dauerhaft erwies sich deren Mobilisierungsfähigkeit aber nicht. Nach 1969 versank die NPD in der Bedeutungslosigkeit, während die CDU vor allem auf Länderebene massive Wahlerfolge verzeichnete – ein Absorptionsprozess durch den demokratischen Konservatismus, der heute nicht mehr ohne Weiteres gelingt. Der rechtsradikale Flügel zog sich in den Untergrund zurück, wo Terrorstrukturen wie die 1973 in Nürnberg gegründete »Wehrsportgruppe Hoffmann« entstanden; Anfang der achtziger Jahre folgte eine bis dahin vergleichslose Welle rechter Gewalt in der Bundesrepublik.
Rassismus, Solidarität und rechte Gewalt in West und Ost (1980er Jahre)
Woran liegt es, dass die Mobilisierung von rechts erst Ende der siebziger/Anfang der achtziger Jahre, dann aber stetig, wieder Erfolge verzeichnete? Es spricht einiges dafür, dass nun die zeitgenössisch so bezeichnete »Fremdenfeindlichkeit« zum effektiven Hauptschmiermittel avancierte. Einschneidende wirtschaftliche Rezessionen, die erste und zweite Ölpreiskrise 1973 und 1979, steigende Arbeitslosigkeit und allgemeine Zukunftsängste korrespondierten mit der zunehmenden (Asyl-)Migration in die Bundesrepublik. »Ausländer« wurden als Konkurrenten um begrenzte gesellschaftliche und wirtschaftliche Ressourcen stigmatisiert – ein Argumentationsmuster, das seine Wirksamkeit bis heute nicht verloren hat.
Bereits zu Beginn der »Gastarbeiter«-Anwerbung Mitte der fünfziger Jahre hatte es Ressentiments gegen die ausländischen Kollegen und Kolleginnen gegeben. Solange die »Gastarbeiter« jedoch nur auf Zeit im Land blieben und in der Phase ökonomischer Saturiertheit das Wirtschaftswunder beförderten, war man ihnen mit einer Art wohlwollender Ignoranz begegnet. Ablehnung war ihnen vor allem dann entgegengeschlagen, wenn sie die Schwelle zum Alltag der Deutschen überschreiten wollten, wovon beispielsweise Schilder zeugten, die Gastwirte an ihre Türen hängten: »Ausländer unerwünscht« oder »Keine Türken« stand darauf (Möhring 2013, S. 286, Fn 7).
Seit Anfang der achtziger Jahre war Migration – auch aus anderen Kulturkreisen – in der Bundesrepublik sichtbarer als je zuvor: Einerseits zogen viele »Gastarbeiter« nach dem konjunkturbedingten, wenngleich schon vorher verhandelten Anwerbestopp 1973 ihre Familien nach. Andererseits stiegen seit Ende der siebziger Jahre die Asylbewerberzahlen drastisch und überschritten 1980 die Marke von 100.000: Flüchtlinge kamen aus dem kommunistischen Vietnam, nach dem Militärputsch 1980 aus der Türkei oder nach der Verhängung des Kriegsrechts 1981 aus Polen. Die zunehmend aus außereuropäischen Ländern stammenden Menschen personifizierten eine sich globalisierende und zugleich in wachsendem Maße unsicher erscheinende Welt, in der die angeblich »Fremden« als Konkurrenten um begrenzte Güter wahrgenommen wurden. Damals entstand die bis heute wirkmächtige Figur des »Scheinasylanten« und »Wirtschaftsflüchtlings«, dessen vermeintliche Privilegierung durch den Staat zum festen Element rechter Mobilisierungsstrategien wurde.
Die Spannbreite rassistischer Stigmatisierung und Gewalt reichte von alltäglicher Diskriminierung auf dem Schulhof oder Übergriffen auf der Straße und in den öffentlichen Verkehrsmitteln bis hin zu Anschlägen rechtsextremer Terrorgruppen. Das Oktoberfest-Attentat im Jahr 1980, über das anlässlich des 40. Jahrestages wieder intensiv diskutiert wurde, war dabei ein Gewaltereignis unter vielen, das vor allem durch seine schiere Dimension breit mediale Beachtung fand. Im selben Jahr verübte ein (wie der NSU aus zwei Männern und einer Frau bestehendes) Trio der vom Neonazi Manfred Roeder geleiteten Deutschen Aktionsgruppen zahlreiche Anschläge. Anfang 1981 erschossen Mitglieder der Wehrsportgruppe Hoffmann den ehemaligen Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Nürnberg, Shlomo Lewin, und seine Lebensgefährtin Frida Poeschke, in der Silvesternacht desselben Jahres wurde der Türke Seydi Battal Koparan von rechten Rockern erschlagen. Es ist erstaunlich und erklärungswürdig, dass diese und weitere Akte rechter Gewalt wissenschaftlich wenig aufgearbeitet und gesellschaftlich kaum erinnert wurden und im Schatten der pogromartigen Ausschreitungen Anfang der neunziger Jahre etwa in Rostock-Lichtenhagen blieben. Das ist auch darum ein Manko, weil ohne diese Vorgeschichte der militant rassistische Nationalismus nach 1989/90 in Ost- und Westdeutschland nicht zu verstehen ist.
Читать дальше