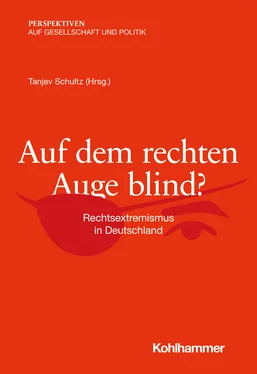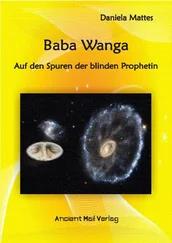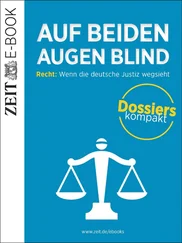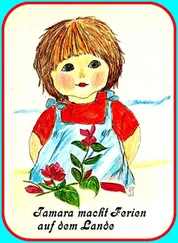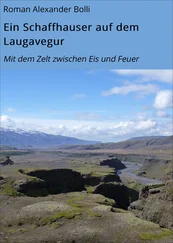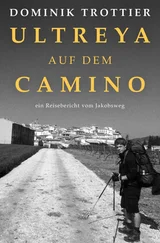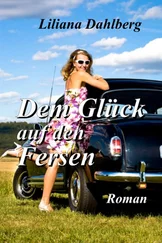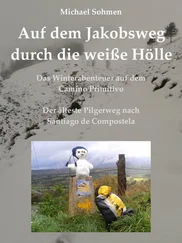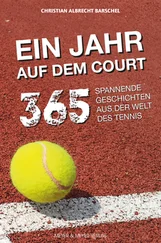Die Erinnerung an den Nationalsozialismus und seine Verbrechen ist in Deutschland fest verankert, sie prägt die politische Kultur, auch wenn die AfD diese Kultur zu zerstören sucht. Auffällig ist, wie schwer es sogar den liberalen »Eliten« und jenen Bürgern, denen die AfD ein Graus ist, bisher gefallen ist, den Rechtsextremisten der Gegenwart ins Auge zu blicken.
Das Oktoberfest-Attentat von 1980 ist manchen auch heute noch ein Begriff, aber wer kennt sich schon aus mit den vielen anderen Anschlägen? Wem sagt die »Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front« etwas oder die »Wehrsportgruppe Hoffmann«? Das waren militante Gruppen, deren Umtriebe schnell wieder aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht wurden – und damit auch die Erinnerung an die Opfer.
Auf dem rechten Auge blind? Im »Kalten Krieg« sahen die Sicherheitsbehörden den Gegner im Osten und bei den Linken. Später, nach dem Anschlag auf die USA am 11. September 2001, konzentrierte sich die Politik auf den Islam und den dschihadistischen Terrorismus. Islamistische Attentäter galten als größte Gefahr, Polizei und Geheimdienste wurden entsprechend ausgerichtet und aufgerüstet.
Die Attentäter vom 11. September hatten ihre Pläne in Hamburg geschmiedet, bevor sie in die USA aufbrachen. Die Existenz der »Hamburger Zelle« war für den deutschen Sicherheitsapparat ein Schock und eine Schmach. Die Amerikaner stellten unangenehme Fragen, die Bundesrepublik stand unter Druck. Zwar verweigerte Bundeskanzler Gerhard Schröder eine Teilnahme am Irak-Krieg, ansonsten aber war Deutschland bemüht, sich am »War on Terror« zu beteiligen. Dieser Krieg, der sich gegen Islamisten richtete, rückte den Kampf gegen den Rechtsextremismus weiter in den Hintergrund. Doch die gewaltbereiten Neonazis waren immer noch da. Einige, wie die Terroristen des NSU, waren genau in den Jahren aktiv, in denen alle Welt auf bärtige, muslimische Männer starrte.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Der dschihadistische Terrorismus, der von religiösen Fanatikern ausgeht, war und ist eine ernst zu nehmende Bedrohung. In den Jahren nach 9/11 haben das die zahlreichen Attentate in Europa – in Madrid und London, Kopenhagen und Berlin – auf brutale Weise gezeigt, zuletzt erst wieder in Wien, Nizza und Paris. Jahrelang erweckten Behörden und Politiker aber den falschen Eindruck, nichts reiche an diese islamistische Gefahr heran. Und in Deutschland hatte man ja Übung darin, den Blick nicht zu weit nach rechts zu wenden.
Als dann der NSU im November 2011 entdeckt wurde, zeigte sich der damalige Generalbundesanwalt Harald Range geschockt. Das sei »unser 11. September«, sagte er. Damit drückte er auch das Entsetzen darüber aus, dass Polizei und Geheimdienste die Gefahren des rechten Terrorismus so lange unterschätzt und die wahren Hintergründe von zehn Morden übersehen hatten.
Der Schock hatte keine heilsame Wirkung. Die Aufklärung der NSU-Verbrechen gestaltete sich zäh, ein echter Umbau der Behörden wurde versäumt, und spätestens in der aufgeheizten Atmosphäre der Jahre 2015/16, in denen in Deutschland erbittert über die Aufnahme geflüchteter Menschen gestritten wurde, witterten Rechtsextremisten Morgenluft. Zeitweise verging kein Tag, an dem nicht irgendwo Asylbewerber attackiert wurden. Es bildeten sich neue gefährliche Gruppierungen, wie die Szene der »Reichsbürger« oder die militante »Gruppe Freital« – sowie, überwölbend, eine digitale Gemeinschaft des Hasses, die Attentäter wie in Halle oder Hanau zu öffentlichen Inszenierungen ihrer Anschläge inspiriert.
Mittlerweile wirken viele Ermittler auf glaubwürdige Weise alarmiert und die Politik hat ihre Anstrengungen im Kampf gegen den Rechtsextremismus verstärkt. Die Bundesregierung entschied im März 2020, einen Kabinettsausschuss »zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus« einzusetzen. Er sollte konkrete Maßnahmen vorbereiten. Die Sicherheitsbehörden waren zuletzt erkennbar bemüht, gewaltbereite Gruppen rechtzeitig aufzuspüren und zu zerschlagen.
Allerdings ist diese neue Scharfsichtigkeit getrübt, weil zugleich immer mehr problematische Vorfälle innerhalb der Behörden entdeckt werden. Die Meldungen über Chatgruppen, in denen sich Polizisten NS-Symbole oder zynische Witze über Asylbewerber zuschickten, rissen in den vergangenen Monaten gar nicht ab. Dazu kamen jahrelang erfolglose Ermittlungen der hessischen Polizei, die in den eigenen Reihen nach den Urhebern von Todesdrohungen gegen Personen des öffentlichen Lebens suchte. Unter dem Kürzel »NSU 2.0« hatten unter anderem die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Başay-Yıldız und die Kabarettistin Idil Baydar furchtbare Nachrichten erhalten, die auch vertrauliche Informationen enthielten, welche aus Polizeidateien stammen könnten. Nachweislich hatten Personen – mutmaßlich Beamte – in Dienststellen der Polizei irreguläre Abfragen zu den bedrohten Personen vorgenommen. Der Fall weitete sich aus und war bis zum Druck dieses Buches noch immer nicht aufgeklärt.
Auf dem rechten Auge blind? Für die Betroffenen der Drohungen ist es alles andere als beruhigend, wenn sie den Eindruck gewinnen, dass die Behörden und ihre Beamten die rechtsextreme Szene nicht bloß unterschätzen – sondern womöglich mit ihr verbunden sind. Verfestigt sich dieser Eindruck und zieht er Kreise, untergräbt das die Fundamente der Demokratie und des Rechtsstaats. Und genau das ist es ja, was Neonazis und rechte Terroristen wollen.
Vor diesem Hintergrund will dieses Buch in kompakter Form auf das Problem aufmerksam machen und die Geschichte und Gegenwart des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik in den Blick nehmen. Die Autorinnen und Autoren kommen aus unterschiedlichen Disziplinen. Ihre Beiträge stehen für sich selbst, können also auch einzeln und in veränderter Reihenfolge gelesen werden. Zusammen ergeben sie ein scharfes Bild von der Lage. Die Historikerin Franka Maubach zeigt, wie sich Rassismus und Rechtsextremismus in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg wieder verbreiteten oder verfestigten. Paul Middelhoff erklärt, was unter der Neuen Rechten zu verstehen ist, die sich in der Gegenwart verstärkt in den öffentlichen Diskurs einschaltet. In diesem Zusammenhang steht auch der Erfolg der »Alternative für Deutschland« (AfD). Ihr Höhenflug als Partei war im Corona-Jahr 2020 zunächst beendet, nicht zuletzt aufgrund innerer Streitigkeiten. Wie sich die AfD langfristig entwickelt, lässt sich derzeit aber kaum prognostizieren.
Matthias Quent liefert in einem weiteren Abschnitt des Buches eine soziologische Analyse, mit der er die Dimensionen des Problems ordnet und dabei unter anderem näher auf die Bedeutung des Antisemitismus und die Merkmale des Rechtsterrorismus eingeht. Dass Gewalt und Terror gesellschaftlich eingebettet sind und deshalb, jenseits einer engen juristischen Betrachtung, die Rede von »Einzeltätern« in die Irre führt, zeigt auch der Beitrag von Wilhelm Heitmeyer, Manuela Freiheit und Peter Sitzer. Sie sprechen von einem »Eskalationskontinuum« und illustrieren anhand eines Zwiebelmodells, wie sich im Rechtsextremismus verschiedene Schichten von Akteuren und Milieus auseinanderblättern lassen. Heitmeyers langjährige Forschung zum Thema in seiner Langzeitstudie »Deutsche Zustände« hätte die Gesellschaft längst für die Bedrohungen von rechts sensibilisieren müssen.
Warum sich auch die Sicherheitsbehörden in der Vergangenheit so schwer damit taten, analysiere ich als Herausgeber in einem Abschnitt zur Polizei und den Geheimdiensten. Der Zwischenruf des Bundespolizisten Andreas Roßkopf, der beteuert, der Großteil seiner Kolleginnen und Kollegen habe mit Extremismus nichts am Hut und versehe den Dienst zuverlässig und einwandfrei, kontrastiert mit dem Urteil des Herausgebers, es gebe sehr wohl ein tiefsitzendes Problem in den Dienststellen. Wer dieses Problem lösen will, muss unbedingt die rechtsstaatlich integren Beamten für entsprechende Reformen und eine Neuausrichtung der Behörden gewinnen. Auch viele Polizisten sind entsetzt und frustriert darüber, wie viele rechtsextreme Vorfälle in den eigenen Reihen zuletzt ans Licht kamen. Es werde im Dienst auch zu wenig auf schwierige Situationen des Berufsalltags eingegangen, schreibt Andreas Roßkopf. Die Aus- und Fortbildung müssten noch besser werden.
Читать дальше