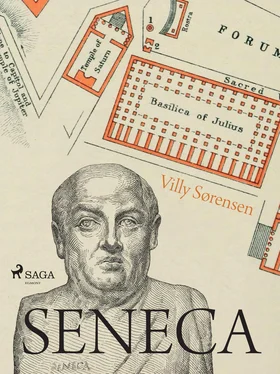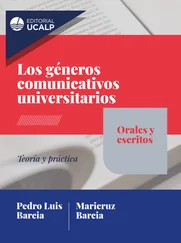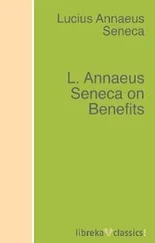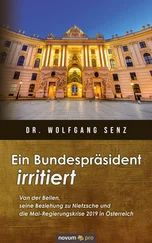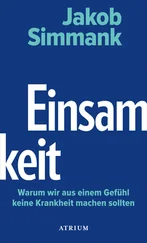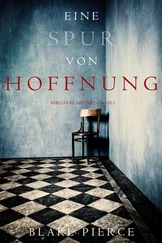Am letzten Tag seines Lebens im Jahre 14 n. Chr., in dem Monat, der nach ihm benannt wurde, soll er seine Freunde gefragt haben, ob er seine Rolle nicht gut gespielt habe. Darin möchten einige ihre Auffassung bestätigt sehen, daß Augustus sich seiner politischen Rolle bewußt gewesen sei, jedoch nicht an seine göttliche Sendung geglaubt habe. Wenn es so wäre, müßte Augustus hoch über die Vorstellungswelt seiner Zeitgenossen erhaben gewesen sein, und nichts deutet darauf hin, daß er so souverän war. Ronald Syme, von dem das klassische Werk über die römische Revolution 45stammt, die zum Prinzipat führte (die seiner Meinung nach eine Klassenrevolution war, da sie den Senatsadel entmachtete – freilich übernahm keine andere Klasse die Macht), ist so sehr darum bemüht, das so wenig Souveräne an Augustus zu betonen, dem er seine Schwächlichkeit sogar übel zu nehmen scheint, daß es völlig unbegreiflich wird, wie dieser schwächliche, heuchlerische Mensch in dieser harten Welt überhaupt etwas habe leisten, geschweige denn den Grundstein zu einem Weltreich legen können, das mit seinen angeborenen Schwächen doch immerhin ein halbes Jahrtausend überdauerte. Syme muß zu der unwahrscheinlichen Erklärung greifen, dies habe auf einer Reihe unwahrscheinlicher Glücksfälle beruht.
Auch wenn dies die Erklärung sein sollte, so war das Glück, fortuna, für den Römer eine Schicksalsmacht, die dem Kühnen beistand; Glück stand nicht im Gegensatz zu persönlichem Verdienst, sondern war dessen Lohn. Die Grenze zwischen menschlich und göttlich war im Altertum nicht so wissenschaftlich bestimmt wie in neuerer Zeit. Wer Großes schuf, der tat dies nach der Bestimmung des Schicksals, mit der Billigung der Götter und kraft des Göttlichen in ihm selbst, deshalb wurden Cäsar und Augustus nach ihrem Tode zu Göttern erhoben. Augustus glaubte wohl kaum, daß es nur sein eigenes Verdienst gewesen sei, daß bei der Schaffung des Friedens das Glück auf seiner Seite gestanden hatte, nicht umsonst wurde auf dem Marsfeld in Rom, dem Zentrum der Bautätigkeit des Augustus, nicht nur ein Altar für den Frieden, sondern auch einer für das Glück, die fortuna, errichtet. Augustus hatte Glück bei der Friedensstiftung; das war sein Verdienst und der Wille des Schicksals, deshalb konnte er sich in aller Bescheidenheit als Werkzeug der Götter fühlen, und das tat er sicher auch.
Doch die Haltung zum Frieden und zur fortuna änderte sich mit der Zeit.
Ist der Frieden erst eine Realität, kann er auf die Dauer nicht die gleiche Begeisterung wecken wie am Anfang. Während es wie eine Befreiung wirken kann, daß aus schlechten Zeiten gute werden, mag es als eine Selbstverständlichkeit erscheinen, daß gute Zeiten besser werden. Das wirtschaftliche Aufblühen des Reiches ließ sich ebenso schwer mit der Genügsamkeit der Vorväter vereinen wie der Frieden mit ihren kriegerischen Tugenden. Nicht weiter verwunderlich, daß Augustus mit seinem Freund Mäcenas eine bewußte Kulturpolitik führte und die Dichter zu engagieren versuchte, damit sie das Volk in Atem und in Stimmung hielten, was Horaz mit seinen Römischen Oden, die die alten römischen Tugenden priesen, auch tat. Es ist jedoch ein Widerspruch, weiterhin die Vergangenheit zu preisen, wenn die Gegenwart den offiziellen Status des goldenen Zeitalters hat, und es gab einen jüngeren Dichter, nämlich Ovid, der sich nicht engagieren ließ, sondern völlig neue Töne anschlug:
„Lobe das Alte, wer will. Ich preis’ es als Glück, daß ich jetzt erst
Lebe; nach Art und Sinn passen wir: ich und die Zeit.
Nicht weil jetzt das geschmeidige Gold aus der Erde gewühlt wird,
Weil man Perlen sich holt von dem entlegensten Strand,
Nicht weil Feld und Gebirg durch Marmorbrüche man abträgt,
Weil man durch Molen des Meers bläuliche Fluten vertreibt:
Nein, weil Bildung herrscht, und der Ahnherrn bäurische Sitte
Nicht mehr dauert und nicht unserer Zeit sich vererbt.“ 46
Augustus konnte seine Freude haben an einem Poeten, der sich so für seine Zeit begeisterte, doch seine Freude war nicht ungetrübt. Es war unerhört, daß man so respektlos von den Bauerntugenden der Vorväter sprach, die Vergil gerühmt hatte, und das noch dazu in einem Gedicht, das „Liebeskunst“ hieß und ebenso gut „Verführungskünste“ hätte heißen können und keineswegs von der gleichen Tendenz geprägt war wie die Sittengesetzgebung des Augustus. Zwischen Vergil und Ovid, der ein Jahr nach Cäsars Tod geboren wurde, bestand ein Generationsunterschied. Vergil verkündete das goldene Zeitalter, Ovid freute sich darüber, daß man das Gold aus der Erde holte, Vergil verankerte die Geschichte im Mythos, Ovid löste die Mythen in Psychologie auf. Er war humoristisch, wo Vergil pathetisch war, und verhielt sich auch ironisch zu den alten römischen Festen, den Fasti, die er in seinem so betitelten Gedicht beschrieb.
Ovid interessierte sich eher für das Glück und Unglück des Individuums als für die Moral der Gesellschaft. In seinem Werk herrschte ein anderer Geist als der römische, den Augustus mit Hilfe der Dichter wiedererwecken wollte. Zwar schließt sein Hauptwerk, die „Metamorphosen“, eine kunstfertig gefügte Reihe griechischer und römischer Mythen mit Verwandlungsmotiv, mit der Apotheose Cäsars und mit dem Wunsch, daß es noch lange dauern möge, ehe auch Augustus als Gott gen Himmel fahre, doch daran schließt Ovid eine Prophezeiung an, die sich nicht mit der Ewigkeit Roms, sondern mit der seines Gedichts beschäftigt, – bei Ovid verfolgt nicht nur das Individuum seine eigenen Interessen, auch die Kunst ist selbstherrlich geworden, für sie ist Rom ein Thema wie jedes andere. Roms mythische Geschichte fließt in die „Metamorphosen“ genauso ein wie alle anderen Mythen, und die Person, die in den Gesängen über Rom den meisten Platz einnimmt, ist weder Äneas noch Augustus, sondern Pythagoras, bei dem König Numa der Sage nach Auskunft suchte. An Pythagoras (der nicht namentlich genannt wird, die Pythagoreer nannten ihn nur Er) ist es, die ernste Moral des humoristischen Gedichts auszusprechen, nämlich daß alles sich in alles verwandelt, Menschen in Tiere, Tiere in Menschen, und daß es ein Verbrechen ist, seine Mitgeschöpfe zu opfern, was in Rom ja eine kultische Handlung war. Pythagoras’ Erklärung für die Tatsache, daß auf der Erde kein goldenes Zeitalter mehr herrsche, ist die, daß der Mensch Geschmack am Fleisch gewonnen habe, was ihn zur Tötung von Tieren veranlasse, und daß tierische Nahrung den Menschen tierisch gemacht habe.
Es ist üblich, den Verfasser der „Liebeskunst“ leichtfertig und oberflächlich zu nennen, aber in seinen „Metamorphosen“ steckt eine tiefere Psychologie als in irgendeinem anderen römischen Gedicht. In der „Liebeskunst“ verhält Ovid sich ironisch zu den moralischen Normen, in den „Metamorphosen“ sind es die tragischen Konflikte zwischen Trieben und Normen, die zu den Verwandlungen führen: der Mensch, der seinen Platz in der Ordnung der Gesellschaft nicht finden kann, geht in den Naturprozeß ein. Es liegt eine gewisse Konsequenz darin, daß Ovid, deutlich pythagoreisch inspiriert, vom Individualismus der „Liebeskunst“ in eine größere Gemeinschaft oder Bruderschaft als die des Staates flüchtet – in beiden Fällen ging er nach Augustus’ Geschmack zu weit. Augustus verbannte ihn nach Tomi (Konstanza) am Schwarzen Meer. Die offizielle Begründung war seine unsittliche „Liebeskunst“, die jedoch acht Jahre zuvor erschienen war, aber es gab darüber hinaus einen verborgeneren Grund: Ovid hatte einer Sache beigewohnt, der er nicht beiwohnen durfte, möglicherweise war er bei einer pythagoreischen Séance 47zugegen gewesen, in der man sich astrologisches Wissen über die Kaiserfamilie zu verschaffen suchte. Was immer die Ursache auch gewesen sein mag: der Geist von Ovids Werk ist ein Symptom dafür, daß etwas nicht gelungen war; Augustus verbannte das Symptom.
Читать дальше