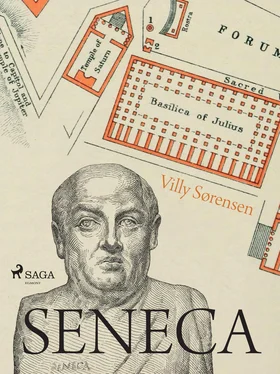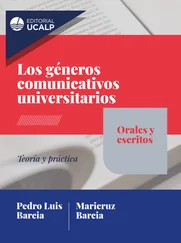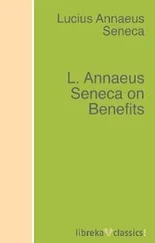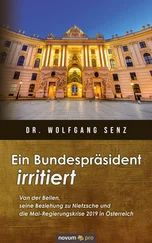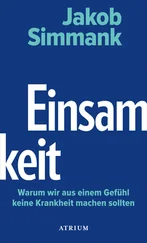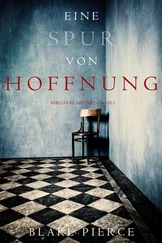Mit der Äneis verfolgte Vergil seine Prophezeihung vom goldenen Zeitalter weiter und ließ die Geschehnisse der Gegenwart nicht nur eine Folge der vergangenen, sondern sogar deren Zweck sein: Augustus war der, der da kommen sollte, das war bereits dem Stammvater des Geschlechts klar:
„Dies ist der Mann, er ist’s, der so oft vom Schicksal verheißne
Caesar Augustus, des Göttlichen Sohn, der das goldene Alter
Wieder nach Latium bringt, dort, wo vor Zeiten Saturnus
König gewesen.“ 38
Es ist nicht weiter verwunderlich, daß ein Dichter einem Machthaber schmeichelt, das hat es auch vor und nach Vergil gegeben. Erstaunlicher ist, daß ein so inspiriertes Gedicht wie die Äneis alles fassen konnte, was ein Machthaber begehren konnte (das könnte dem Dichter Skrupel eingebracht haben – wollte er möglicherweise deshalb das unvollendete Gedicht bei seinem Tode vernichtet sehen? Dies ist das Thema von Hermann Brochs großem Roman „Der Tod des Vergil“) – und das nicht, weil Vergil gefallen oder den Wünschen des Machthabers nachkommen wollte, denn so etwas hat nie sonderlich inspirierend gewirkt, sondern einfach deshalb, weil Augustus der „mythischen“ Bereitschaft der Zeit entgegenkam: Für das Volk und für die Dichter war er der, der da kommen sollte. Auch Horaz, der anfangs die Räumung von Rom zugunsten der glückseligen Inseln vorgeschlagen hatte, lokalisierte das goldene Zeitalter schließlich in Rom. Der Frieden mußte auf eine Generation, die nie etwas anderes als Krieg erlebt und ein „mythisches“ Entsetzen vor dem sich nähernden Ende aller Zeiten gehegt hatte, wie ein Wunder wirken.
Vergil läßt in der Äneis Jupiter selbst die Theorie dementieren, wonach Roms Tage gezählt seien:
„Diesem setze ich weder ein Ziel noch Frist für die Herrschaft.
Reich ohne Grenzen sei ihm beschieden.“ 39
Kein Evangelium konnte Augustus willkommener sein. Er verstand es, den Zeitgeist zu nutzen. Im Jahre 17 v. Chr., sechs Jahre nachdem Roms zweites Großjahr zuende gegangen war, fand er es an der Zeit, den Beginn des neuen Weltalters zu feiern. Dies geschah in einem zwölf Tage dauernden „Jahrhundertfest“, an dem ganz Rom teilnahm. Vielleicht gelang es hier zum ersten und letzten Mal, das gesamte römische Geschlecht um einen geistigen Inhalt zu vereinen, so wie das bei den Festen der Sippengesellschaft der Fall gewesen war. Zu dieser Gelegenheit – zwei Jahre nach Vergils Tod – war es Horaz, der die Adventshymne, carmen saeculare, verfaßt hatte. Gesungen wurde sie von einem Doppelchor römischer Jungen und Mädchen, die den Wunsch ausdrückten, die goldene Zeit möge noch goldener werden und ewig dauern. Rom, dessen Tage von Anbeginn an gezählt waren, hieß von nun an die Ewige Stadt.
Eine große Gesellschaft kann nur schwer den Charakter geistiger Gemeinschaft bewahren, der die kleine Gesellschaft kennzeichnet. Darin lag eine der Ursachen für die wachsenden inneren Schwierigkeiten des wachsenden römischen Reiches. Die Schwierigkeiten, das Problem des mythischen Königs Numa, beginnen bereits dort, wo mehrere Stämme in einer Gesellschaft zusammenleben sollen, die auf Recht und Gesetz, und nicht auf Verwandtschaftsgefühl, beruht. Wenn die ursprünglichen Selbstversorgerfamilien allmählich in eine stärker durch Arbeits- und Klassenteilung geprägte Gesellschaft eingehen, erhöht sich die gegenseitige Abhängigkeit aller von allen – aber der Zusammenhalt wird schwächer. Es ist kein Zufall, daß die ersten Tempel für die Götter des Staates in den ersten Jahren der Republik gebaut wurden: die Staatsreligion war in Rom ein politisches Mittel, um den Staat zusammenzuhalten. Niemand hat das klarer und zynischer ausgedrückt als Polybios:
„Der größte Vorzug des römischen Gemeinwesens aber scheint mir in ihrer Ansicht von den Göttern zu liegen, und was bei anderen Völkern ein Vorwurf ist, eben dies die Grundlage des römischen Staates zu bilden: eine beinahe abergläubische Götterfurcht. Die Religion spielt dort im privaten wie im öffentlichen Leben eine solche Rolle und es wird so viel Wesens darum gemacht, wie man es sich kaum vorstellen kann. Vielen wird das wahrscheinlich seltsam erscheinen, ich glaube indessen, daß es um der Masse willen geschieht. Denn wenn man ein Staatswesen bilden könnte, das nur aus Weisen besteht, würden solche Methoden wohl nicht nötig sein. Da jedoch die Masse immer leichtfertig und voller gesetzwidriger Begierden ist, geneigt zu sinnlosem Zorn, zu Leidenschaften, die sich in Gewalttaten entladen, bleibt nichts übrig, als sie durch dunkle Angstvorstellungen und eine gut erfundene Mythologie im Zaum zu halten. Die Alten scheinen mir daher die Vorstellungen von den Göttern, den Glauben an die Unterwelt nicht unüberlegt, sondern mit kluger Überlegung der Menge eingeflößt zu haben, und es scheint mir im Gegenteil höchst unbedacht und unverständig, wenn man ihr jetzt diesen Glauben austreibt.“ 40
Die Staatsreligion war in der Auflösungszeit der Republik vernachlässigt worden, was gerade darauf hindeutet, daß es sich dabei eher um die Sache der Machthaber als um die der bedrängten Bürger handelte, die in diesen unruhigen Zeiten ihre Zuflucht zu östlichen Friedensreligionen oder zum Stoizismus und Neupythagoreismus nahmen. Doch obgleich sich die intellektuelle Elite zu den traditionellen Göttern etwas ironisch verhalten und sich zu ihnen mit einer ähnlichen Zurückhaltung bekennen konnte, wie es in Ovids Worten: „Götter sind nützlich für uns: drum laßt an Götter uns glauben“, 41angedeutet wird, so ist es nicht richtig, wenn zuweilen behauptet wird, daß die Religion während der Kaiserzeit überhaupt ihre Macht über die Gemüter eingebüßt habe. Alle uns bekannten Römer, von den plumpen Ex-Sklaven im Roman des Petronius bis zu Ovid selbst, hatten sich ein ursprüngliches Gefühl dafür bewahrt, daß es etwas hinter den Dingen gebe, wenn sie sich auch verschiedene Vorstellungen von diesem Etwas machten.
Die altrömischen Götter waren Personifikationen oder eher Abstraktionen alltäglicher, insbesondere bäuerlicher Tätigkeiten und gruppierten sich vor allem um die Übergangssituationen im Leben: Geburt, Hochzeit, Tod, für die die mythische Phantasie immer eine Vorliebe gehabt hat. Laut John Ferguson 42traten bei einer Geburt neunzehn Götter in Funktion, die nur in dieser einen Funktion existierten. Mit allen ihren Spezialgöttern für dies und jenes hatten die Römer die primitive Erlebnisweise sozusagen formalisiert und die Gottesfurcht organisiert, so daß sie zur Furcht vor einer Nichteinhaltung der Regeln wurde. Die juristische Pedanterie ist charakteristisch für den römischen Kult, Möglichkeiten der Ekstase gab es darin nicht. Viele der Feste der primitiven bäuerlichen Gesellschaft lebten in mehr oder weniger entstellter Form weiter. Das Saturnalienfest, das man am 17. Dezember feierte, war ein altes Neujahrsfest und bezeichnete, ebenso wie die Feste der Stammesgesellschaft, eine Rückkehr in die Vorzeit, in das goldene Zeitalter, als Saturnus regierte und alle gleich waren. Die sozialen Normen wurden außer Kraft gesetzt, das furchtbare Chaos des Beginns brach durch als eine Mahnung an das Willkürliche aller menschlichen Einrichtungen. Doch die Saturnalien, die dem Individuum die Möglichkeit gaben, seine soziale Rolle zu verlassen (der Sklave wurde zum Herrn und der Herr zum Sklaven), stellten die alten Stammesfeste eigentlich auf den Kopf, da das Individuum in ihnen gerade seine überindividuelle soziale Rolle realisiert hatte. Sie trugen eher den Charakter von Zerstreuung und Zügellosigkeit als von Sammlung und Ekstase, und das gleiche galt für die blutigeren Volksfeste, die ihre Blütezeit während der Kaiserzeit erlebten.
Augustus, der ja nicht jedes Jahr ein Jahrhundertfest veranstalten konnte, versuchte auf viele andere Weisen die Römer um Roms Idee und Aufgabe und um sich selbst zu scharen. Eine seiner ersten Initiativen war die Wiederherstellung der Staatsreligion. Er wiedereröffnete 82 Tempel und unterstrich seine Nachbarschaft zu den Göttern, indem er neben seiner eigenen Residenz auf dem Palatin einen Tempel des Apollo bauen ließ, so wie er einen Venustempel auf Cäsars Forum baute, denn das julische Geschlecht stammte ja von Venus ab, und einen für Mars auf seinem eigenen Forum, denn Mars war der Vater des Romulus und damit der Vater des römischen Volkes.
Читать дальше