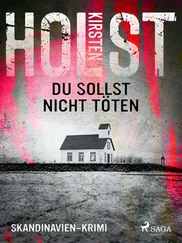Ich stand in unserem Schlafsaal und wollte gerade meinen Rucksack auspacken, als Thomas kam und fragte, ob ich beim Hölzchenwachsen mitmachen wollte.
Ich wußte nicht, was das bedeutete – vieles hier schien in einer Art Geheimsprache abzulaufen. Weil ich das nicht zugeben wollte, antwortete ich einfach nur: »Wo?«
»Zwei Schlafsäle weiter.«
Wir mußten anklopfen und ein Losungswort nennen, und als wir eingelassen worden waren, war mir sofort klar, warum. Dort saßen nämlich ein paar muntere Jungs auf ihren Etagenbetten und holten sich einen runter.
Ich hatte mich verhört. Thomas hatte nicht »wachsen« gesagt, sondern »wichsen«, und dieses Spiel war mir durchaus vertraut, nur hatte ich es noch nie zusammen mit anderen gemacht.
Wir wetteiferten miteinander, und ich schnitt gar nicht schlecht ab, schließlich traf ich zu Hause in meinem Zimmer immer den Papierkorb.
Anfangs hatte ich es im Badezimmer gemacht, aber wenn ich das zu lange blockierte, dann klopfte meine Mutter an die Tür und fragte: »Du piddelst doch wohl nicht an dir herum?«
Nein, das meinte sie nicht damit, sie dachte, ich drückte mir Pickel oder Mitesser aus. Ich wußte nie, was ich antworten sollte, aber ich kann mir vorstellen, daß sie mich in Ruhe gelassen hätte, wenn ich die Wahrheit gesagt hätte.
So oder so, ich bewunderte Thomas, und ich beneidete ihn. Er hatte einfach alles im Griff, verfügte über irgendeine Form von angeborener Autorität, und als wir richtig in die Pubertät kamen und ich nur noch aus Armen und Beinen, großem Mund und Adamsapfel bestand, wuchs er nur einfach gleichmäßig vor sich hin, und alles verlief bei ihm ganz harmonisch, als ob es eine Aufgabe wäre, die er so gut wie möglich lösen wollte.
Damals sagte Mini eines Tages zu mir: »Meine Fresse, Mann, was ist der Unterschied zwischen dir und der Polizei vor hundert Jahren?«
»Was?« fragte ich.
»Die Polizei vor hundert Jahren hatte Pickelhauben, aber du hast bloß Pickel!«
Er hatte recht, ich sah aus wie ein wandelndes Geschwür, während Thomas’ Haut einfach nur »erwachsener« wurde und bei ihm der Bartwuchs einsetzte.
Morgens beguckte ich mich im Spiegel und wünschte, ich könnte so aussehen wie Thomas. Wie das Idol, the golden boy, wonderboy, nach dem alle Mädchen verrückt waren.
Aber auch wenn die Pickel nach und nach verschwanden und ich Arme und Beine unter Kontrolle bekam – ich würde doch nie so aussehen wie Thomas. Ich würde niemals sein Filmstargesicht und die tollen dunklen Haare bekommen. Ich tröstete mich damit, daß er sicher später eine Glatze kriegen würde; sein Vater hatte nämlich eine. Aber vor allem würde ich niemals dieses gewisse Etwas bekommen, das Thomas zu jemand ganz Besonderem machte.
Er war nicht so verrückt wie Mini, und er war längst nicht so albern wie ich, aber trotzdem lachten wir viel miteinander. Wir trieben auch zusammen Sport, zuerst Fußball, später Schwimmen und Federball, aber als wir so fünfzehn, sechzehn wurden, verloren wir das Interesse daran. Thomas jedenfalls. Unser Schwimmtrainer war stocksauer, als wir aufhörten, in Gedanken hatte er uns schon als Olympiasieger gesehen. Wir hatten den richtigen Körperbau dazu, behauptete er, und die Kraft – aber leider fehlte uns die Energie. In den letzten beiden Jahren, bevor Thomas wegging, brachten wir bloß noch ein paar Radtouren und ein bißchen Joggen zustande, und als Thomas dann als Austauschschüler in Amerika war, fing ich an, mit Lisbeth Federball zu spielen.
Er fuhr Ende August in die USA, kurz nachdem wir aufs Gymnasium gewechselt waren. In Lilleby gibt es kein Gymnasium, deshalb kamen wir aufs Gymnasium in die nächstgrößere Stadt, nach Storeby, wo Agathe, Anne und die meisten anderen aus unserer Klasse wohnen und das nur zwölf Kilometer von Lilleby entfernt liegt.
Thomas wollte eigentlich ein ganzes Jahr in den USA bleiben, aber er kam schon Anfang Mai zurück, weil sein Vater einen Herzinfarkt gehabt hatte. Ich fand das ziemlich schwachsinnig, denn dem Vater ging es gar nicht so schlecht, und aus irgendeinem Grund konnte Thomas kein neues Visum mehr bekommen, wenn er erst einmal nach Hause gefahren war. Das behauptete er jedenfalls, aber ich hatte auch das Gefühl, daß er Ärger mit einem Mädchen gehabt hatte, auch wenn er das nicht direkt so sagte. Ich ging davon aus, daß ich eines schönen Tages erfahren würde, was wirklich los gewesen war, schließlich erzählten wir uns immer alles.
Es war typisch Thomas, daß er wieder in die Klasse hineinglitt, als ob er niemals fortgewesen wäre.
»Was ich verpaßt habe, holen wir in den Sommerferien nach«, sagte er.
Es war auch typisch, daß er einfach erwartete, daß ich mit ihm zusammen lernen würde. Wir büffelten los, und ich ging das gesamte Pensum des Schuljahres zweimal durch, aber trotzdem war Thomas besser als ich. Im Vergleich mit ihm würde ich immer Nummer zwei bleiben.
Ich war glücklich darüber, daß er sich nicht für Agathe interessierte, denn er hätte sie mir jederzeit wegschnappen können, da war ich mir sicher. Thomas bekam immer, was er haben wollte, er brauchte bloß darauf zu zeigen. Aber zum Glück hatte er nie auf Agathe gezeigt.
Statt dessen wollte er offenbar Anne. Ehe er losgefahren war, waren die beiden ein bißchen zusammengewesen, und nach seiner Rückkehr ging es einfach so weiter, als ob nichts passiert wäre – ob er nun drüben eine andere gehabt hatte oder nicht.
Jetzt betrachtete ich Thomas, wie er da auf dem Strandweg vor mir herging, und zwei Zeilen, die ich nachts gelesen hatte, jagten mir durch den Kopf:
So kräftig und geschmeidig,
als ginge er zum Tanz.
Damit könnte Thomas gemeint sein, dachte ich. So würde er immer gehen, und wenn es zu seiner eigenen Hinrichtung wäre. Ich habe ja schon gesagt, daß ich damals ein Riesenbaby war, und es war eine kindlich-romantische, sentimentale Vorstellung, die mit dem Buch und diesem ganz besonderen Augustmorgen zu tun hatte – aber in diesem Moment erschien mir Thomas wirklich so.
Als wir zurückkamen, war auf der östlichen Terrasse vor dem Eßzimmer ein riesengroßes Frühstücksbüfett aufgebaut.
»Hannah muß ja schon früh aufgestanden sein«, stellte Mini fest. »Das hat doch nicht Hannah gemacht, du Dussel«, sagte ich. »Das war die Ayah.«
»Ja, die Ayah, die Ayah«, grinste Mini. »Ich glaub’, so eine schaff’ ich mir später auch an. Das ist besser und billiger als eine Ehefrau.« »Traust du dich auch, das vor den Ohren der Mädchen zu sagen?« sagte Thomas lachend.
Die Ayah hatte schwer geschuftet. Sie hatte alles allein gemacht, war auf ihren nackten Zehen herumgerannt und überall und nirgends gewesen. Nach dem Abendessen am Freitag waren einige Mädchen aufgestanden, um abzuräumen, aber Hannah hatte sie daran gehindert.
»Laßt das nur stehen. Darum kümmert sich die Ayah.«
»Aber wir können doch helfen!«
Hannah hatte den Kopf geschüttelt. »Lieber nicht ... Sie, na ja, um ehrlich zu sein, ihr verliert in ihren Augen das Gesicht, wenn ihr das macht.«
Wir glotzten sie allesamt an.
»Wir verlieren das Gesicht?« fragte Agathe verwundert.
»Ja.« Hannah sah ein bißchen verlegen aus, aber ich konnte nicht feststellen, ob sie sich wegen uns oder wegen der Ayah genierte. »Es ist nicht leicht zu erklären, aber – versteht ihr, es ist nicht euer Job, und deshalb ... Sie ist doch an andere Normen gewöhnt, nicht wahr?«
Agathe nickte und sah aus, als ob sie das wirklich verstanden hätte. Ich wußte aber nicht so recht, ob uns anderen das auch gelungen war.
Hannah kam gerade aus dem Eßzimmer, als Thomas, Mini und ich die Terrasse betraten. Sie sah frisch, gesund, ordentlich gebügelt und etwas altmodisch aus in ihrem weißen Rock und der rosa Bluse.
Читать дальше