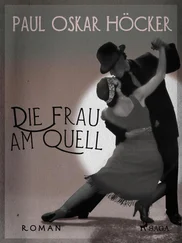Frau Babin hatte mit ihren beiden Töchtern inzwischen den Ausgang erreicht. Überflüssigerweise begleitete der Professor die Damen bis zum Tor. Es war ein stolzherablassender Blick, mit dem sie sich von dem Deutschen verabschiedeten.
Erst als Helene allein mit dem jungen Offizier war, entsann sie sich der seltsamen Art der drei. Einen Augenblick ward sie unsicher. Sie musste ihren Freundinnen doch wohl den Zusammenhang erklären ... Und dabei huschte ihr’s durch den Sinn, dass Frau Babin ihr auf dem Herweg gestanden hatte, dass sie kein Geld bei sich trug, und die Vorstellung ängstigte sie, die drei müssten den endlos langen Weg bis zum Tor und durch die ganze, grosse Stadt bis zum anderen Ende von Lille zu Fuss zurücklegen ... Aber Léonie oder Yvonne, so beruhigte sie sich, waren doch wohl sicher im Besitz der paar Sous ... Wie ausgewischt war dann gleich wieder diese kleine Sorge: Hans West hatte sie ins Haus geführt, und im Eingang zu dem Kasinoraum beugte er sich auf ihre Hand und küsste sie und sprach in so warmem, herzlichem Ton zu ihr.
„So glücklich bin ich, Frau Martin, so glücklich, dass ich Sie hab’ wiedersehn dürfen!“
Seit Monaten die ersten deutschen Worte. Ihr war ganz wunderlich zumute. Es kam ihr vor, als würde sie aus einer Gefangenenzelle freigelassen. Der einzige Umgang mit gebildeten Menschen, den sie seit einem Vierteljahr hatte, war der mit Frau Babin und deren Töchtern, allenfalls mit Challier oder Dubois, dem Bauunternehmer. Sie hatte sich in ihrer Verbannung schon ganz unters Pack gestossen geglaubt. Nun fühlte sie sich seelisch gestreichelt, da sie wieder ihre Muttersprache hören und sprechen durfte. Und es tat so wohl, wieder einmal einen lichten Raum mit weiss gedeckten Tischen, hellen Vorhängen und Blumen zu sehen.
Der Professor war stolz, dass das Kasino heute Damenbesuch aufzuweisen hatte. Er liess Kaffee besorgen. Das war doch einmal ein Erlebnis; er konnte seiner Frau schreiben, dass er die Besitzerin des Schlösschens hier in ihren eigenen Räumen empfangen hatte. Seine Frau würde natürlich eifersüchtig sein. Eine Französin! Wenn er nun gar schrieb, dass sie kaum dreiundzwanzig Jahre zählte, eine vollendet schöne Pariser Figur hatte und seidenweiche lange Wimpern ... Nein, das wollte er lieber doch nicht schreiben. Aber es war auch wieder nicht nötig, zu verraten, dass sie „eigentlich“ eine Deutsche war. Denn — wie er seine Frau kannte — verminderte das in ihren Augen das Prickelnde des Abenteuers ihres Mannes, auf das sie im Grunde doch stolz war.
In dem Augenblick, in dem der Bursche des Batterieführers das Kaffeegeschirr hereinbrachte, ging die Alarmklingel. Der Bursche, der gleichzeitig Munitionsträger war, stellte seine klirrende Last hastig hin — und kaum zwanzig Sekunden darauf machte der erste Schuss der Abwehrkanone das ganze Gebäude zittern.
Helene Martin fuhr die ersten paar Male wohl stark zusammen; aber rasch gewöhnte sich ihr Ohr an die Erschütterung. Es war ja so ein ganz absonderliches Erlebnis, eine Rückkehr in Kreise, die ihr schon so weltenfern erschienen waren. In der Gesellschaft der Franzosen, die so schwer unter der deutschen Herrschaft litten, hatte die dem Deutschen innewohnende Mischung von Taktgefühl, Schwäche, Mitleid, Verständnis und Gutmütigkeit sie immer wieder davon abgehalten, die Gerechtigkeit der Massnahmen ihrer ehemaligen Landsleute zu verteidigen, zu erklären. Ihr Schweigen zu den Anklagen war aber mehr und mehr als Billigung aufgefasst worden. Sie hatte die Gewaltherrschaft ja allerdings selbst so grausam einschneidend empfunden. Hier aber fühlte sie sich wieder einmal geborgen. Ja, das Bewusstsein, dass deutsche Geschütze es waren, die den am Himmel auftauchenden Feind vertrieben, war ihr eine gute Beruhigung. Sie blickte durch das Rundfenster — ach, hier hatte George nach einem Entwurf von Baily Scott einen lauschigen Blumenerker herzaubern wollen — und mit Spannung sah sie den zerberstenden weissen Schneeballen nach, die dicht bei der schwarzen Fliege in die blassrote Luft hineingesetzt wurden von der Abwehrbatterie des bayerischen Professors.
„Ein paar Wochen wird mein Kommando wohl dauern,“ sagte der Oberleutnant. „Jetzt freu’ ich mich darüber. Als es hiess, ich komme wieder zum Gouvernement, da wollte mir’s gar nicht passen. Was sollte ich in Lille? Aber nun bleibt mir doch die Genugtuung: ich kann ein bisschen für Sie sorgen. Sie haben mir doch Ihre Freundschaft erhalten, wie?“
Wie sie am Fenster stand, im vollen Lichte, hatte ihre Erscheinung etwas geradezu Rührendes. Auch das unmoderne, schon stark abgetragene Kleid wirkte da mit. Bei seiner Durchfahrt durch Brüssel hatte er die eleganten Belgierinnen in ihrer neuesten Frühjahrsmode auf den Boulevards gesehen: sie trugen kurze, flotte, weite Röcke. Helene ging noch in demselben dunkeln, knappgearbeiteten, schlichten Gewand, in dem er sie im Oktober getroffen hatte. Als der Flieger droben am blauen Himmel entschwunden war, wandte sie sich um. Die Hände, an denen sie schwarze Zwirnhandschuhe trug, verschränkte sie im Rücken, sich auf das Fensterbrett stützend.
„Ich bin ein müder, vergrämter Mensch geworden, lieber Freund,“ sagte sie, „und meine Wege sind jetzt so ganz, ganz andere, dass es für Sie kaum mehr irgendeine Verbindung zu Ihrer alten Jugendbekannten gibt. Ich habe mich auch gefreut, Sie wiederzusehen, herzlich gefreut; aber das Wiedersehen ist zugleich ein Lebewohlsagen.“
Er schüttelte den Kopf. „Ich suche Sie auf. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich muss sehen, wie Sie leben.“
„Nein, das sollen Sie nicht. Ich will es nicht. Unter keinen Umständen.“
Ihr Ton machte ihn unruhig. „Hat Ihre Umgebung das Licht zu scheuen, Frau Martin? Wo leben Sie?“
Sie sah ihn starr und ernst an, fast streng. Dann stiess sie aus: „Im Elend. Irgendwo. Bei den Wällen.“
„Etwa — auf dem Fabrikhof?“ Er entsann sich der unheimlichen Gegend im Südosten der Stadt, wo die Beschiessung Hunderte von Häusern in Trümmerstätten verwandelt hatte. Da er ihr Schweigen für Zustimmung nehmen musste, fuhr er fort: „Aber das ist doch kein Aufenthalt für Sie! Um Gottes willen! Mit Ihren früheren Freunden haben Sie sich erzürnt? Warum? Ihr Deutschtum hat Sie auseinandergebracht. Aber wovon haben Sie gelebt?“
Sie wehrte sich innerlich noch. Doch dann sagte sie es ihm: „Ich habe Wäsche genäht. Für ein Geschäft. So — jetzt wissen Sie alles. Und es wird Ihnen daraus klar werden, dass ich bis zum Ende dieses grauenvollen Krieges in meiner Verbannung bleiben muss.“
„Nein, Frau Martin, den Grund sehe ich nicht ein.“
„Ich will keine Almosen. Ich muss jetzt abwarten, wie mein Mann sein Schicksal gestaltet hat. Das seine — und damit das meine.“
„Sie haben nichts mehr von ihm gehört?“
„Nichts mehr. Ich weiss nur, dass er im Oktober in Paris gewesen sein muss.“
„Sie wissen mehr, Frau Martin. In Ihren Augen steht ein so tiefer Schmerz ... Haben Sie doch Zutrauen zu mir!“
Helene seufzte. „Ich fürchte für ihn ...“
„Sie lieben ihn noch?“
Eine ganze Weile schwieg sie. Tränen waren ihr in die Augen getreten. Sie rannen einzeln über ihre Wangen. Sie hob die Hand nicht, um sie wegzuwischen. „Ich nehme an, dass ich wohl Nachricht von ihm hätte, wenn sie ihn wieder in ein Gefangenenlager gebracht hätten — etwa, weil sie die Naturalisation so kurz vor dem Krieg nicht anerkennen wollten.“ Immer zögernder sprach sie. „Aber weil ich keine Nachricht von ihm habe, so muss ich wohl glauben — oder fürchten ...“
„Sprechen Sie doch, Frau Martin! Was fürchten Sie?“
„Dass George ins französische Heer eingetreten ist, um — Schwierigkeiten auszuweichen.“
„O — das wäre!“ Mit grossen Augen sah er sie an. „Arme Frau!“
Der Professor kam von seinem Dienst zurück. Ein paar Schrapnelle hatten ausgezeichnet gelegen.
Читать дальше