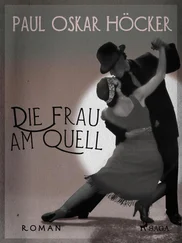Hier hauste die Erbin von Millionen, die verwöhnte Tochter des Kommerzienrats Kampff, der bei seinem Tod eine Firma von Weltruf hinterlassen hatte, hier hauste die junge Frau des „smarten“ George Martin, dem die schönsten Perlen, das rascheste Auto, die kostbarsten Orchideen, die prächtigste Villa noch eben gut genug für sie hatten scheinen wollen. Geneviève, trotzdem sie früher als freiwillige Helferin des Roten Kreuzes, später im Dienst des Geheimen Hilfsausschusses ihres Vaters schon Tausende von Gängen in Armenwohnungen und Krankenstuben hinter sich hatte, konnte doch kaum hinwegkommen über die krasse Vorstellung, dass Helene hier Zuflucht gesucht hatte, ihre Freundin Helene, die sie in der Pension in Dinant wegen ihrer vornehmen Haltung, wegen ihrer schönen Erscheinung, wegen ihres gewinnenden Wesens alle, alle so leidenschaftlich angeschwärmt hatten.
Didelot war durch das Elend stumpf geworden, auch durch die Untätigkeit. Früher hatte ihn die Aufsicht hier auf dem grossen Fabrikanwesen dauernd in Atem gehalten. Nach Kriegsausbruch war er lange Zeit hindurch ganz allein in der Fabrik gewesen. Da hatte er täglich einen Angriff des Gesindels, das bei den Wällen hauste, befürchten müssen.
Es hiess, die Fabrik sei deutscher Besitz. Es hing an einem Haar, dass geplündert und verwüstet wurde. Besonders damals, als die Deutschen Brüssel und Antwerpen einnahmen. Aber die Besitzerin hatte nachgewiesen, dass ihr Mann französischer Bürger war; der Wachtmeister von der Porte de Valenciennes hatte es selbst am Fabriktor mit grossen Buchstaben angeschrieben. Von da an liessen sie das Grundstück in Ruhe. Später hatte eine deutsche Militärbehörde alle Vorräte an landwirtschaftlichen Maschinen abgeholt. Und die englischen Flieger hatten dann noch die leeren Schuppen in Trümmerstätten verwandelt.
Seitdem gab es nichts zu befürchten, nichts zu verwalten mehr. Didelot musste zufrieden sein, dass ihm Frau Martin die kleine Miete zahlte. Von der Mairie bekam er wöchentlich eine Anweisung an die spanischamerikanische Lebensmittelverteilung. Vor dem Verhungern war man geschützt. Und „c’est la guerre“ — damit tröstete er sich wie Millionen andere in dem vom Feind besetzten Land.
Mit Leuten seines Schlages wusste Geneviève gut zu sprechen. Sie war ein tapferer Mensch. Ihr Vater, der glühende Patriot, gab ihr Tag für Tag ein Beispiel. Er war durch den Krieg von seinen Weingütern in der Champagne abgeschnitten — Gott mochte wissen, wie es auf denen aussah —, auch mit seinen Zweiggeschäften in Arras und Armentières hatte er keine Verbindung mehr, — aber alles, was er hier an Geldmitteln flüssig machen konnte, opferte er der Sache Frankreichs. Da galt es, Unglücklichen zu helfen, besonders den hungernden Soldaten, die sich seit der Einnahme der Stadt verborgen hielten, noch immer auf die Vertreibung der Deutschen hoffend, oder denen man Mittel und Wege wies, heimlich über die holländische Grenze zu entkommen, um drüben dem Vaterlande ihre Dienste wieder widmen zu können.
Der Einarmige stand an dem kalten Ofen und sog an der erloschenen Pfeife. Ab und zu warf er einen scheuen Blick nach der Tür oder durchs Fenster. Dann musterte er wieder das ernste junge Ding, das ihn nach dem und jenem der Schützlinge ihres Vaters fragte. Solche Französinnen gab es hier nicht in seinem Bereich. Die Weiber klagten nur, die Mädchen beklatschten einander. Eine trug es der andern nach, wenn sie’s mit einem Deutschen hielt. Aber wenn sie hübsch genug waren und Geld brauchten — und sie hatten ja keinen Verdienst sonst mehr —, dann sträubten sie sich nicht allzu ernstlich.
So lange dauerte der Krieg jetzt schon — im vorigen Sommer hatte es geheissen, im Oktober spätestens ständen die Verbündeten in Berlin — wo steckten die tapferen Poilus, nach denen sie sich sehnten? Die Jugend, die Einsamkeit und die Not trieb die armen Dinger den Boches in die Arme — was halfen da die schwarzen Listen!
Nun wusste Geneviève genau Bescheid über Helenens Umgebung. Und ihr Entschluss stand fest: sie musste sie hier wegholen. Jetzt würde Helene die ihr gebotene Hand auch wohl dankbar ergreifen. Die deutsche Heimat, in die sie hatte zurückfinden wollen, stiess sie von sich. Sie musste endlich einsehen: sie gehörte dem Lande, das ihr Mann jetzt Heimat nannte, dessen Schutz er genoss, drüben, jenseits der Schützengräben. Es galt den letzten Rest dieser unfruchtbaren Gefühle zu überwinden. Ach, wenn nur erst ihr Vater mit Helene reden konnte, er verstand es, zu Herzen zu sprechen, die Lauen aufzurütteln. Eine Frau wie Helene, die von ihren ehemaligen Landsleuten so mitleidslos ins Elend gestossen worden war, musste den heiligen Hass in sich erwachen fühlen. Und diesen heiligen Hass galt es zu schüren — um ihn für die grosse Sache auszunutzen.
Seit Wochen zum erstenmal hatte sich Helene heute einen arbeitsfreien Sonntag gegönnt. Sie war mit Frau Babin und deren beiden Töchtern nach Tisch spazierengegangen. Wenn es Yvonne nicht zu sehr anstrengte, wollten sie bis zum Boulevard Madeleine. Vielleicht nahmen sie auch die Strassenbahn, die nach Roubaix führte, bis zu dem Bauplatz, auf dem sich der Rohbau des Martinschen Landhauses befand. Didelot konnte nicht sagen, wann die Damen zurückkehren würden. Vor Dunkelwerden wohl kaum.
Geneviève hatte ihrem Vater versprochen, Helene auf alle Fälle sofort mitzubringen. Er lag daheim in der Inkermanstrasse im Billardzimmer auf dem Diwan, hatte fiebrige Augen und heisse Hände. Von dem Augenblick an, da er erfuhr, Helene Martin weile noch in Lille, hatte es ihm keine Ruhe mehr gelassen. Es hatte Genevièves ganzer Überredungskunst bedurft, ihn davon zurückzuhalten, dass er sie begleitete. Mama und die Geschwister waren schon wieder sehr, sehr eifersüchtig auf Helene. Sie alle wussten, wie tief die Neigung zu der schönen jungen Frau in seinem Herzen wurzelte, wie schwer er damals gelitten hatte, als sie unter dem Einfluss ihres Jugendfreundes, des jungen deutschen Offiziers, sich entschlossen hatte, Lille zu verlassen.
„Ich gebe zu Hause nur Bescheid und komme dann gleich wieder zurück,“ sagte sie zu Didelot. Sie steckte ihm einen Liller Stadtschein zu. „Und wenn Sie’s gut meinen mit Frau Martin, wirklich gut, dann helfen Sie mir, sie wegzubringen von hier. Papa gibt Ihnen, was Sie von ihr bekommen haben. Er ist ja herzensgut. Und er schickt gewiss auch Tabak. Ja, soll ich’s ihm sagen? Ich werde öfter nach Ihnen sehn, wenn ich in die Gegend komme. Draussen in der Rue Roiselle hausen ein paar arme Teufel, die vom Ausschuss Unterstützung haben. Warum hat Antoine sich nie gemeldet? Musste er da am Boulevard Vauban so eine hässliche Szene machen?“
Der Pförtner hob seufzend die Schultern. „Neun Francs die Woche — es hält schwer, damit auszukommen, Fräulein Laroche. Alles ist so teuer geworden. Fleisch schon gar nicht mehr zu haben.“
„Es ist ja nur für den Übergang. Papa hat jetzt tüchtige Agenten an der Hand. Ebenezer Drachman richtet den Dienst an der holländischen Grenze ein. Jede Woche bringen sie einen Schub hinüber.“ Sie sah ihn strahlend an. „Vorgestern war es der hundertste.“
„Alles Leute vom fünften und achten Territorialregiment? Die damals vor den Deutschen geflüchtet sind?“
„Hauptsächlich. Aber es sind ja noch immer Hunderte versteckt. Auch von den Dreiundvierzigern. Sie wagen sich bloss nicht ans Licht — vertrauen selbst den nächsten Bekannten nicht mehr. Es gibt ja auch leider so viele Liller, die ihre Landsleute um ein Trinkgeld an die Deutschen verraten würden. Darum heisst es: vorsichtig arbeiten!“
„Und Sie haben gar keine Furcht, Fräulein Laroche, dass irgendein schlechter Kerl Sie einmal angeben könnte?“
Sie schüttelte den Kopf. „Ich habe keinen Feind. So wenig wie Papa je einen Feind hatte.“
„Wären nur alle Franzosen so wie Sie und Ihr Vater.“ Hüstelnd klopfte er die kalte Pfeife aus. „Der Krieg hat hier viele, viele schlecht gemacht, Männer und Frauen. Ich glaube nicht mehr daran, dass Frankreich sich je wieder erholt von diesen Schlägen.“
Читать дальше