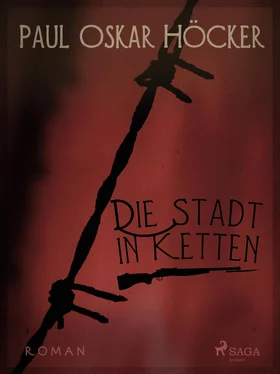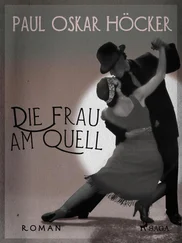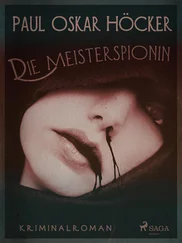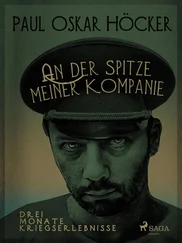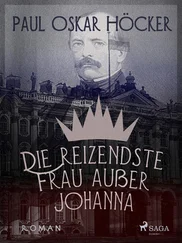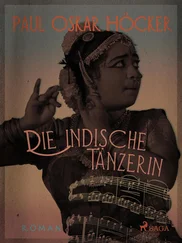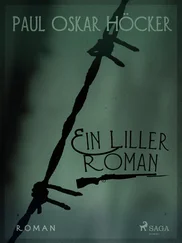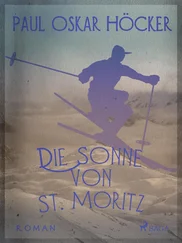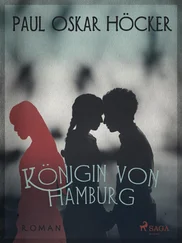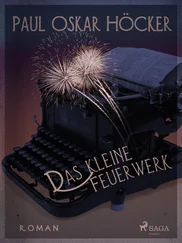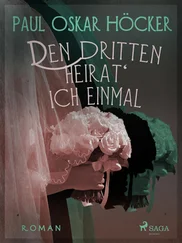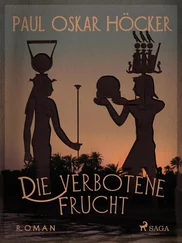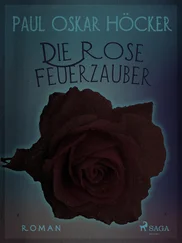„Didelot —!“ Sie rief es in hellem Zorn. Ein paar Augenblicke suchte sie nach Worten. Aber dann schüttelte sie den Kopf und sagte lächelnd: „Sie werden ja bald einmal Papa sehen und hören, Didelot. Der wird Ihnen schon den Kopf zurechtsetzen. Und das Herz.“ An der Tür drehte sie sich noch einmal um, und ein Lächeln huschte über ihr ernstes Gesicht. „Und den Tabak werde ich nicht vergessen.“
Auch als Geneviève zum zweitenmal kam, war Helene von ihrem Sonntagsausflug noch nicht zurückgekehrt. Das war dem Alten ganz unbegreiflich. Es war schon weit über acht Uhr — um Neun aber war Zapfenstreich für die gesamte Bevölkerung. Vielleicht war Frau Martin noch mit den Babins nach der Rue Trochu gegangen. Didelot hätte die junge Dame gern noch dahin begleitet, aber in der Dunkelheit, die hier herrschte, wagte er den nächtlichen Ausflug nicht: wer nach Zapfenstreich einer Patrouille der Deutschen begegnete, der musste zur Wache mit.
Geneviève wartete, wartete. Zehn Minuten vor Neun musste sie’s aufgeben, die Freundin heute noch zu sprechen. Und nun galt es einen Eilmarsch, um noch vor dem neunten Glockenschlag die Rue Inkerman zu gewinnen. Unweit des Hauses befand sich die Post. Der deutsche Wachtposten, der dort an der Ecke stand, würde sie nicht ohne weiteres vorbeilassen. Sie hielten sich an den Buchstaben ihrer Befehle, diese starrköpfigen Landsturmleute aus Göttingen und Kiel.
Das Abendkonzert der Engländer bei Armentières hatte wieder eingesetzt: Geschützdonner rollte, der Regen kündende Westwind trug zuweilen sogar das Prasseln des Maschinengewehrfeuers herüber. Die Gasse, die zur Fabrik führte, lag tot und schwarz da. Nur durch den roten Vorhang des Estaminetfensters drüben drang ein Lichtschimmer auf die Strasse.
Didelot fasste es nicht, dass die stille, ängstliche, vergrämte junge Frau, die hier nun schon seit Monaten nur der Arbeit lebte, es wagte, das strenge Gebot der Deutschen zu übertreten. Es schlug von der Hospitalkapelle bei der Porte de Douai schon zehn Uhr, als hastige Schritte sich näherten. Der Alte tastete sich in den Fabrikhof und öffnete vorsichtig die Nebenpforte. „Madame —?!“
Ja, sie war’s. Bleich und doch erregt, noch atemlos von der Hast, wohl auch von der Angst, unterwegs von einer Patrouille angehalten zu werden, huschte sie herein.
„Gottlob!“ stiess sie aus, als sie in der Pförtnerwohnung war.
Sie ging in ihr Zimmer, legte Hut und Jacke ab und setzte sich im Dunkeln auf die Bettstatt. Inzwischen hatte der Einarmige das Fabriktor und die Haustür geschlossen. Mit der Laterne kam er an die Schwelle ihrer Stube und fragte, ob er ihr die Lampe anzünden sollte.
„Nein, nein, danke.“ Dann entsann sie sich, dass er ihrethalben länger als sonst aufgeblieben war, und gab eine kurze Erklärung. Yvonne Babin war unterwegs ohnmächtig geworden; der Spaziergang hatte die Kleine zu stark angegriffen; sie hatten Mühe gehabt, sie nach Hause zu bringen; und Challier hatte noch einen Arzt herbeigeholt.
Didelot seufzte. Er hätte jetzt wohl wieder sein übliches: „C’est la guerre“ angebracht. Aber etwas Unerwartetes geschah. Die stille, gelassene, sonst immer so unverdrossene junge Frau liess sich plötzlich zur Seite sinken, schlug mit dem Kopf aufs Bett und schluchzte — schluchzte so herzzerbrechend, so hingegeben einem tiefen, schweren Leid, dass der Einarmige seine Formel vergass. Durch seinen Sinn flog etwas wie die Erinnerung an eine Zeit, über die ein Menschenalter hingegangen war, an Frühlingswanderungen in der jung erwachenden Natur Flanderns. Bekümmert, mitleidig und voll Verstehens sagte er: „C’est le printemps, madame!“
Eine Antwort kam nicht. Die junge Frau weinte noch immer. Allmählich klang es etwas ruhiger, leiser. Didelot machte einen Gang durch die Küchenstube. Dann zog er die Wanduhr auf. Darauf wartete er ein Weilchen stillgeduldig. Da das leise Weinen aber nicht aufhörte, schlürfte er auf der knarrenden, sandbestreuten Diele zur Tür, harrte hier abermals einer Weisung, die nicht kam, einer Erklärung, die er nicht erwarten konnte, einer Gelegenheit, über den Besuch von Fräulein Laroche zu sprechen. Sie weinte, weinte ... Da zog er denn endlich so geräuschlos, als das verquollene Holz es zuliess, die Tür ins Schloss, nahm die Laterne auf und begann seinen seit so vielen Jahren gewohnten Rundgang durch die zerstörte Fabrik, in der es nichts mehr zu bewachen gab ...
Die Fliegerabwehrbatterie bei Madeleine war neu aufgestellt. Theo West, der Fliegerleutnant, der kürzlich Staffelführer geworden war, kam auf einer Autofahrt vom Oberkommando der Armee dort vorbei, liess halten und machte dem Batterieführer seinen Besuch. „Ich hab’ sie bisher immer nur aus der Vogelschau gesehen,“ sagte er zu dem bayerischen Landsturmoberleutnant, „da drängt’s einen doch, ihr einmal so ganz gemütlich die Vorderflosse zu drücken, der aufmerksam-freundlichen Revolverkanone.“
Der fünfzigjährige Batterieführer war daheim Professor der Mathematik. Der Krieg hatte ihn wieder jung gemacht. Nachdem er in den ersten Monaten eine Feldbatterie im Bewegungskrieg geführt hatte, erschien ihm diese neue Tätigkeit wegen der Erprobung all der wissenschaftlichen Berechnungen besonders anregend. Weit vor der Stadt gelegen, einsam, ohne Anlehnung an die Gärten und Landhäuser der reichen Industrievorstadt, bot die Batteriestellung für einen Weltmenschen wenig; aber der weisshaarige Oberleutnant brauchte weder Geselligkeit noch Naturschönheit, noch Ablenkung, der Dienst und seine Mathematik füllten ihn vollkommen aus. Übrigens hatten sich’s seine Leute hier leidlich bequem gemacht. Ein erst im Rohbau fertiggestellter, grosszügig angelegter Landhausbau diente ihnen als Quartier. Aus verlassenen Häusern in der näheren und weiteren Nachbarschaft war allmählich alles herbeigeschafft worden, was dazu dienen konnte, den Winter erträglich zu machen. Mit einigem Stolz zeigte er dem jungen Flieger, dessen Name in der Armee schon so rühmlich bekannt war, die Anlage. Vom Batterieplatz hatte man kaum zweihundert Schritt bis zum „Kasino“, das in dem wohl als Musiksaal gedachten, baulich am weitesten vorgeschrittenen Erdgeschossraum des Landhauses eingerichtet war. Die kalkweissen Wände wiesen flott hingezeichnete Spottbilder auf.
„An Talenten ist kein Mangel in der Batterie,“ sagte der Bayer, „einer meiner Geschützführer ist Dekorationsmaler am Münchner Hoftheater, der Fernsprecher ist Redakteur vom ‚Simpel‘, der Schreiber ist einer von der Sternwarte, und der Zugführer — schauen S’, das ist der, den s’ da mit der Klampen abgemalt haben — der hat noch im vorigen Sommer in Bayreuth am ersten Pult mitgegeigt. Die einzige Entschuldigung für so viel Talent — hat unser Kronprinz neulich gesagt und hat gelacht — ist die, dass die Batterie auch gut schiessen kann. Wir sind doch hier seine Leibbatterie. Aber das obere Stockwerk müssen S’ sich noch anschauen, Herr Kamerad. Ich hab’ den Zugang vernageln lassen, weil’s schad drum wär’, wenn mein Kanoniervolk mit den tranigen Kommissstiefeln da herumtrampeln sollt’... Parkett, spiegelblank alles, und eingebaute Möbel, Kirschholz mit Thujaeinlage, geschliffene Kristallscheiben, echtes Material, ein ganz vornehmer Geschmack, muss man schon sagen.“
Der Flieger lachte. „In neuen Villen hier in Frankreich sonst eine Seltenheit. Mein Gott, was für elenden Kitsch hab’ ich hier schon auf Schlössern und in Grossstadthäusern gesehen! Was nicht Louis ist oder Empire — das ist rettungslos ödester Fabrikreinfall.“
„’s ist auch kein Eingeborener, der sich das Schloss hat dahersetzen wollen, sondern ein Zugereister. Scheint mir so eine Art internationaler Grossmogul. Auch englischer Einfluss dabei. Grossartige Badezimmeranlagen. So was kann man hier in Lille lange suchen. Auf zweihundert Häuser eine Badewanne — und da funktioniert todsicher der Badeofen nicht. Wenn ich den Mann von der Mairie recht verstanden hab’, ist’s ein Schwiegersohn von dem Kommerzienrat Kampff, wissen S’, dem Begründer der deutschen Kampff-Werke ... Landwirtschaftliche Maschinen und so ein Zeugs.“
Читать дальше