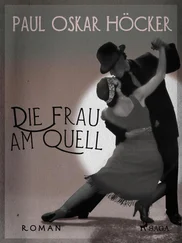Paul Oskar Höcker
Die Stadt in Ketten
ein neuer Liller Roman
Saga
Über das russgeschwärzte Gemäuer des inneren Fabrikhofes, der überall die Spuren des englischen Fliegerangriffs aufwies, ragte der blühende Prunus. Frau Helene Martin sah ihn von ihrem Fensterplatz aus, an dem sie ihrer mühsamen Näharbeit für das Putzwäschegeschäft in der Rue Neuve oblag. Die Blütenfülle dieses schlankstämmigen Bäumchens war der einzige Gruss, den der Frühling in die niedrige Erdgeschossstube hereinsandte. Bei der Beschiessung von Lille im vorigen Oktober war hier, in der Nachbarschaft der Wälle, ein grosser Teil der Fabrikanlagen in Schutt und Asche gelegt worden. Zwar blieb damals das Grundstück ihres Mannes wie durch ein Wunder verschont; aber die Überfälle der Flieger im Dezember und nach Neujahr, deren Brandbomben wohl dem Arsenal galten, hatten die beiden Lagerschuppen, das Maschinenhaus und die Ställe bei der Pförtnerswohnung zerstört.
Der blinden Vernichtungswut der Engländer war dabei auch das Gärtchen zum Opfer gefallen, das den Stolz Didelots, des einarmigen, schmalbrüstigen Concierge, gebildet hatte. Die beiden Platanen, die viereckig verschnittenen, streckten ihre kahlen, russgeschwärzten Äste wie anklagend zum Himmel empor; die Gemüsebeete wiesen zwei tiefe Trichter auf; das Buschobst war verbrannt.
Auch die Kletterrosen, deren feines Geästel sich als Netz über die breite Wand des Empfangsgebäudes gespannt hatte, zeigten kein Leben mehr. Als klägliche Reste erinnerten nur das Margueritenbeet und die winzige Wäschewiese mit den blauen und weissen Krokus an die einstige Gartenpracht, die Didelot hier dem poesiearmen Industrieboden der Liller Vorstadt abgerungen hatte. Der grosse, kugelförmige Prunus mit seinem festlichen Blütenzauber bildete nun schon seit dem Aschermittwoch Helenens Augenweide. Er gab dem von der Kriegsunbill heimgesuchten, düsteren Fabrikgelände einen farbenfreudigen Mittelpunkt, er gab ihrem müden, glaubensarm gewordenen Herzen den Keim einer Hoffnung daran: dass einmal wieder Friede sein würde, dass auch für ihr jetzt totes Leben der Weckruf eines neuen Frühlings kommen müsse.
Als der Gattin eines Deutschen, der sich vor dem Kriege in Frankreich hatte naturalisieren lassen, war ihr die Erlaubnis zur Heimkehr in das verlorene Vaterland verweigert worden. Ihr Vater war tot, mit der Frankfurter Verwandtschaft ihres bei der Besetzung von Lille nach Paris geflüchteten Mannes bestand keine Verbindung mehr, ihr Bankkonto beim Crédit du Nord hier war aufgebraucht, die Beitreibungsscheine für die zuerst von den Franzosen, dann von den Deutschen beschlagnahmten landwirtschaftlichen Maschinen hatte sie dem drängenden Bauunternehmer verpfänden müssen: für das im Rohbau steckengebliebene Vorstadthaus, das ihr Mann ihr am Boulevard Madeleine errichten wollte. Aus ihrer Stadtwohnung, in der sie bei der Beschiessung von Lille im vorigen Oktober verschüttet worden war, hatte sie nur das nackte Leben gerettet.
Wer sollte ihr helfen? An wen durfte sie sich wenden? Nicht einmal brieflicher Verkehr mit der alten Heimat war ihr möglich. Und ihre Beziehungen hier? Mit ihren Pensionsfreundinnen hatte sie jede Gemeinschaft abgebrochen: Manon Dedonker wandelte leichte Pfade, Geneviève Laroche stand ganz im Bann ihres Vaters, der ein geheimes, gefährliches Spiel gegen die deutsche Militärbehörde trieb. Sie war trostlos vereinsamt. Wenn sich nicht der alte Pförtner ihrer angenommen, ihr das Wohnstübchen seiner verstorbenen Frau angeboten hätte — ihr wäre nur der letzte Weg übriggeblieben: der in den Deulekanal. Didelot hatte ihr auch die Aufträge des Wäschegeschäfts verschafft. Von der kümmerlichen Einnahme bestritt sie nun ihr Leben; und um dem Alten noch einen Anteil davon zukommen lassen zu können, musste sie sehr, sehr fleissig sein.
Überall begann hier schon die Not. Die Zufuhr zur Stadt war knapp. Da sie im Operationsgebiet lag, blieb der Spionagegefahr halber der ganze Verkehr aufs äusserste beschränkt. Der Ausschuss, der mit spanisch-amerikanischer Hilfe sich der Ernährung der eingeschlossenen Franzosen angenommen hatte, meisterte seine schwere Aufgabe nur unvollkommen. Etwas Reis, etwas Dörrgemüse, etwas Kaffee, genau zugemessenes Brot bildete die einförmige Kost.
Aber noch schlimmer als diese äusseren Einschränkungen war für Helene die innere Vereinsamung. Rundum hauste Gesindel. Sie wagte sich nur selten ins Freie, und die zum Teil in Trümmern liegenden Strassen und Gassen des Fabrikviertels durcheilte sie dann klopfenden Herzens, stets in der Furcht, von dem erbitterten Volk, das hier zwischen dem Rand der Grossstadt und den alten Festungswällen sein lichtscheues Wesen trieb, auf ihre deutsche Abkunft angesprochen zu werden. Ihre Jugend lehnte sich gegen dies graue Gefangenendasein auf. Aber die Furcht schlug immer wieder alle Wünsche nieder.
Eine kleine Lebensfreude bot ihr da abends die Begegnung mit den Nachbarn: Frau Babin und ihren beiden Töchtern. Wenn die drei mädchenschlanken Persönchen von ihrer Tagesarbeit aus der Stadt zurückkamen, pünktlich um halb Acht, dann hörte sie die hellen Stimmen, die wie Vogelgezwitscher dem Ohr schmeichelten, immer schon in dem Augenblick, wo das Kleeblatt in die Rue Trochu einbog.
Wie Schwestern wirkten sie: alle drei gleich gross, mit demselben feinen, blassen Gesichtchen, derselben edel geformten Nase, dem aschblonden Haar, den dunklen, seltsam geraden, wie künstlich aufgesetzten Augenbrauen, den veilchenblauen, kindhaft-gläubigen und doch wieder berschmitzten Augen — und alle drei in demselben dünnen, knappanliegenden, der vorigen Sommermode angehörenden Jackenkleid. Frau Babin war eine der seltenen Französinnen, die in dem grossen Kriegsunglück ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen wussten. Von ihrem Mann, dem Oberst, durch die Kriegsereignisse getrennt, aus ihrem hübschen kleinen Landgütchen bei Lesquin durch die Granaten ihrer eigenen Landsleute vertrieben, hatte sie sich im Oktober mit ihren Töchtern zu ihrem Vetter Challier geflüchtet, dem ehemaligen Prokuristen der Martinschen Fabrik. Sie war nicht die Frau, Almosen anzunehmen: seit fünf Monaten arbeitete sie nun schon Schulter an Schulter mit ihren beiden Töchtern im Photographischen Atelier von Bérisal & Co. am Boulevard de la Liberté. Der Weg dahin war weit, die Arbeitszeit lang, der Verdienst schmal. Aber wenn man die drei hübschen Wesen so daherkommen sah, eng aneinandergeschmiegt, zärtlich plaudernd, mit ihren süssen Stimmchen lachend, dann ahnte niemand, wie schwer die Hand des Schicksals auf ihren schmalen Schultern lastete.
Yvonne, die Sechzehnjährige, schleppte zuweilen den linken Fuss ein wenig nach. An solchen Tagen nahmen Mutter und Schwester sie in die Mitte, und dann merkte man es kaum. Aber Challier hatte es Helene einmal verraten: hier herrschte viel Knochentuberkulose, man sah wie in kaum einer anderen Grossstadt wieder so zahlreiche stelzfüssige Männer, Frauen und Kinder, und schon vor Jahren hatte der Arzt um Yvonne Sorge gehabt ...
Helene musste ihnen heute ihren Prunus zeigen. Gerade jetzt fiel ein letzter Strahl der Abendsonne ins Gärtchen und beleuchtete das Bäumchen. Die Stadtbeschiessung hatte in die Brandmauer der benachbarten Chemischen Fabrik eine vielzackige Lücke gerissen; die ward der Üppigkeit des Blütenwunders nun zur Gnade. Selbst Didelot, der spuckend draussen stand und durch die Hornbrille, die er bis auf die Nasenspitze vorgeschoben hatte, das „Bulletin de Lille“ studierte, meinte, sie seien „so schön wie künstlich gemacht“, die Mandelblüten; das bildete bei ihm den Gipfel der Bewunderung.
Frau Babin, Léonie und Yvonne entfalteten natürlich eine reicher gestufte Begeisterung. Sie sprachen alle drei auf einmal — alle drei entsannen sich eines Palmsonntags in Lesquin, wo über Nacht die vier wilden Obstbäumchen am Teich aufgeblüht waren ...
Читать дальше