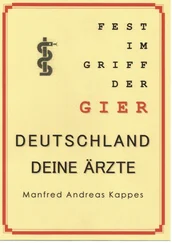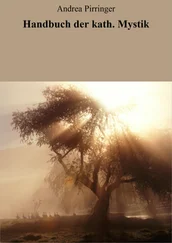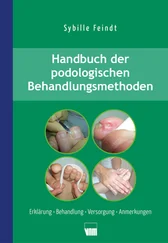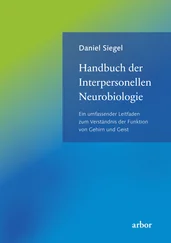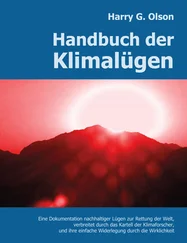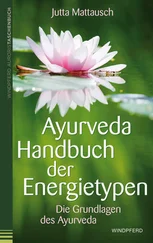bezeichnet der Ausdruck ‚Regional- oder Minderheitensprache‘ Sprachen, (i) die herkömmlicherweise in einem bestimmten Gebiet eines Staates von Angehörigen dieses Staates gebraucht werden, die eine Gruppe bilden, deren Zahl kleiner ist als die der übrigen Bevölkerung des Staates, und (ii) die sich von der (den) Amtsprache(n) dieses Staates unterscheiden; er umfaßt weder Dialekte der Amtssprache(n) des Staates noch die Sprachen von Zuwanderern. (Europarat 1992: 2)
Weiterhin gibt es einen Teil mit allgemeiner gehaltenen Zielen und Grundsätzen, zu deren Anwendung sich die Vertragsparteien verpflichten. Unter Teil III führt die Charta eine ganze Reihe konkreter Maßnahmen zur Förderung des Gebrauchs von Regional- oder Minderheitensprachen im öffentlichen Leben auf. Diese Maßnahmen betreffen Bildungswesen, Justiz, Verwaltungsbehörden und öffentliche Dienstleistungsbetriebe, Medien, kulturelle Tätigkeiten und Einrichtungen, wirtschaftliches und soziales Leben sowie grenzüberschreitenden Austausch. Bei der Ratifizierung des Dokuments müssen für jede als Regional- oder Minderheitensprache im Sinne der Charta anerkannte Sprache mindestens 35 Maßnahmen aus diesem Katalog angegeben werden, zu deren Anwendung sich der Unterzeichnerstaat verpflichtet. In regelmäßigen Abständen haben die Vertragsstaaten Berichte über die Anwendung der Charta vorzulegen, die von einem Sachverständigenausschuss kontrolliert werden; es fehlt allerdings jede Sanktionsmöglichkeit. Die Umsetzung der Fördermaßnahmen ist in Deutschland Sache der einzelnen Länder. Diese Fragmentierung wird bzw. die sich daraus ergebenden großen Unterschiede in der Umsetzung zwischen den einzelnen Bundesländern werden vom Sachverständigenausschuss immer kritisch kommentiert. Dies gilt insbesondere für das Niederdeutsche, dessen Schutz Angelegenheit von insgesamt acht Ländern ist. Der letzte Bericht des Sachverständigenausschusses von 2018 empfiehlt explizit „die Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu verbessern, in denen Niederdeutsch geschützt ist.“
Entsprechend der Einordnung in die erwähnte Handbuch-Serie orientiert sich auch die Gliederung dieses Bandes bzw. der Beiträge an den Vorgängerarbeiten. Pro Beitrag wird ein Gebiet überblicksartig beschrieben und dabei jeweils im Wesentlichen ein „gewisser Kernbestand an Problembereichen“ (Hinderling/Eichinger 1996: XII) behandelt. Die Beschreibungsdimensionen erstrecken sich von den historischen Entwicklungen über die aktuelle demographische und rechtliche Situation bis hin zur Rolle und Präsenz der Minderheitensprache in Wirtschaft, Politik und Kultur. Darüber hinaus wird für jedes Gebiet eine Beschreibung der soziolinguistischen Situation inklusive eines kurzen Profils der Minderheitensprache, der Kompetenz- und Sprachgebrauchssituation, der Spracheinstellungen der Sprecherinnen und Sprecher sowie des visuell realisierten Auftretens der Minderheitensprache im öffentlichen Raum (Linguistic Landscape) geboten.
Die Herausgeber sind allen Beteiligten zu großem Dank verpflichtet: zuvörderst den Autorinnen und Autoren für die Bereitschaft, einen Beitrag zu übernehmen, sich auf das vorgegebene Gliederungsschema einzulassen und es, wo nötig, zu adaptieren. Des Weiteren Norbert Cußler-Volz für die Erstellung einiger Karten im Band. Für die Erstellung der Druckvorlage und die umsichtige und sorgfältige Korrektur der Manuskripte sei Heike Kalitowksi-Ahrens und Julia Smičiklas gedankt. Dem Narr-Francke-Attempto-Verlag danken wir für die Aufnahme des Handbuchs ins Verlagsprogramm und insbesondere Tillmann Bub, der die Entstehung des Bandes ebenso wie die der Vorgängerbände mit freundlicher und unerschütterlicher Langmut betreut hat.
Adler, Astrid/Beyer, Rahel (2018): Languages and Language Policies in Germany/Sprachen und Sprachpolitik in Deutschland. In: Stickel, Gerhard (Hrg.): National Language Institutions and National Languages. Contributions to the EFNIL Conference 2017 in Mannheim. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, S. 221–242.
Beyer, Rahel/Plewnia, Albrecht (Hrg.) (2019): Handbuch des Deutschen in West- und Mitteleuropa. Sprachminderheiten und Mehrsprachigkeitskonstellationen. Tübingen: Narr Francke Attempto.
Eichinger, Ludwig/Plewnia, Albrecht/Riehl, Claudia M. (Hrg.) (2008): Handbuch der deutschen Sprachminderheiten in Mittel- und Osteuropa. Tübingen: Narr.
Europarat (1992): Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen (= Sammlung Europäischer Verträge; 148). Abrufbar unter: https://rm.coe.int/168007c089(Letzter Zugriff 3.4.2020).
Extra, Guus/Gorter, Durk (2007): Regional and Immigrant Minority Languages in Europe. In: Hellinger, Marlis/Pauwels, Anne (Hrg.): Handbook of Language and Communication: Diversity and Change. Berlin: de Gruyter. S. 15–52.
Hinderling, Robert/Eichinger, Ludwig M. (1996a): Einleitung. In: Hinderling, Robert/Eichinger, Ludwig M. (Hrg.): Handbuch der mitteleuropäischen Sprachminderheiten. Tübingen: Narr. S. IX–XVII.
Hinderling, Robert/Eichinger, Ludwig M. (Hrg.) (1996b): Handbuch der mitteleuropäischen Sprachminderheiten. Tübingen: Narr.
Hünlich, David/Wolfer, Sascha/Lang, Christian/Deppermann, Arnulf (2018): Wer besucht den Integrationskurs? Soziale und sprachliche Hintergründe von Geflüchteten und anderen Zugewanderten. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache und Goethe-Institut Mannheim.
Marten, Heiko F. (2016): Sprach(en)politik. Eine Einführung. Tübingen: Narr Francke Attempto.
Plewnia, Albrecht/Riehl, Claudia M. (2018): Handbuch der deutschen Sprachminderheiten in Übersee. Tübingen: Narr.
Rindler Schjerve, Rosita (2004): Minderheit/Minority. In: Ammon, Ulrich et al. (Hrg.): Sociolinguistics. Soziolinguistik. HSK 3.1., 2. Auflage. Berlin/New York: de Gruyter. S. 480–486.
Stickel, Gerhard (2012): Deutsch im Kontext anderer Sprachen in Deutschland heute: Daten und Einschätzungen. In: Eichinger, Ludwig M./Plewnia, Albrecht/Schoel, Christiane/Stahlberg, Dagmar (Hrg.): Sprache und Einstellungen. Spracheinstellungen aus sprachwissenschaftlicher und sozialpsychologischer Perspektive. Tübingen: Narr, S. 227–321.
Dänisch als Minderheitensprache in Deutschland
Karen Margrethe Pedersen / Doris Stolberg
| 1 |
|
Geographische Lage, Demographie und Bevölkerungsstatistik |
|
1.1 |
Geographische Lage |
|
1.2 |
Demographie und Statistik |
| 2 |
|
Geschichte |
|
2.1 |
Die historische Entwicklung bis ins frühe 20. Jahrhundert |
|
2.2 |
1920–1945 |
|
2.3 |
Nach 1945 |
| 3 |
|
Rolle und Präsenz der Minderheitensprache in Bezug auf Wirtschaft, Politik, Kultur und rechtliche Stellung |
|
3.1 |
Wirtschaftliche Situation |
|
3.2 |
Politische Situation |
|
3.3 |
Rechtliche Stellung |
|
3.4 |
Kulturelle Institutionen, Medien und Literatur |
| 4 |
|
Soziolinguistische Situation: Kontaktsprachen, Sprachform(en) des Deutschen und der Minderheitensprache, sprachliche Charakteristika, Code-Switching und Sprachmischung |
|
4.1 |
Kontaktsprachen |
|
4.2 |
Die einzelnen Sprachformen des Dänischen |
|
4.3 |
Sprachenwahl: Code-Switching, Sprachmischung |
| 5 |
|
Spracheinstellungen gegenüber dem Südschleswigdänischen als Schriftsprache |
| 6 |
|
Linguistic Landscapes |
| 7 |
|
Zusammenfassung |
| 8 |
|
Literatur |
1 Geographische Lage, Demographie und Bevölkerungsstatistik
Читать дальше