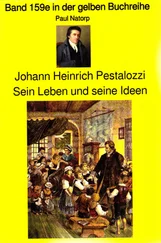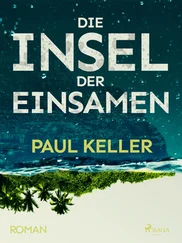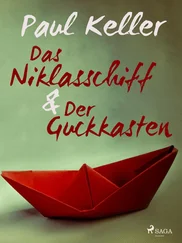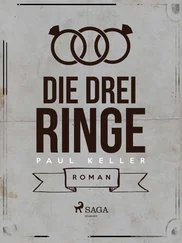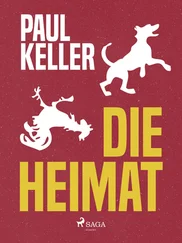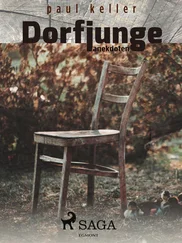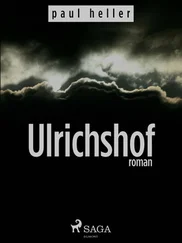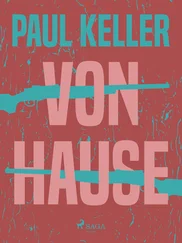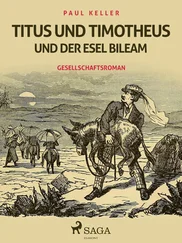Das Schlimmste war, daß sie ihm den besten Kunden wegnehmen wollte. Nichts mehr an Schulden wollte sie bezahlen. Nun, wir wollen mal sehen! Wenn der Gerichtsvollzieher droht, der dem Karl den Sonntagsanzug, den Winterüberzieher und die Uhr pfänden will, werden die Heinrichs schon zahlen. Sie könnten sich ja sonst nicht mehr im Dorfe sehen lassen.
Die Rose blüht,
der Dorn, der sticht —
Hier hatte ein Dorn gestochen. Die Leute kommen noch immer nicht. Der Pfarrer hat wieder zu lange gepredigt. Lange Predigten bedeuten für den Wirt immer eine Schädigung; denn zum Mittagessen wollen die Leute zu Hause sein. Wir werden die Uhr noch um zehn Minuten zurückdrehen.
Langweilig wird’s. Der Wirt betrachtet ein zweites Bild an der Wand: „Die Lebensstufen“. Eine aufwärts und abwärts führende Treppe stellt das Bild dar; auf jeder Stufe steht eine menschliche Figur:
„10 Jahre, ein Kind“ — „20 Jahre, ein Jüngling“ — „30 Jahre, ein Mann“ — „40 Jahre, wohlgetan“ — „50 Jahre, Stillestand“ — „60 Jahre, geht’s Alter an“ — „70 Jahre, ein Greis“ — „80 Jahre, schneeweiß“ — „90 Jahre, ein Kinderspott“ — „100 Jahre, Gnade bei Gott“.
Er war fünfzig — Stillestand! — Schon faul! Aber noch schmeckte das Bier, noch schmeckte das Leben. Zum 50. Geburtstag hatte er eine anonyme Karte bekommen; darauf hatte gestanden: „Wer nichts wird, wird Wirt.“ Das war von irgendeinem Neidhammel. Er hat genug erreicht. Sein Bruder, der Gymnasialdirektor, der sechs Kinder hat, muß ihn um Weihnachten herum immer anpumpen. Und der Bruder gilt doch als ein großes Tier; er duzt sich sogar mit dem Landrat.
Marie Heinrich hatte gedroht, wenn das mit Karl so weiterginge, würde sie sich an den Landrat wenden und sich gar nicht scheuen, den Bruder öffentlich als Trunkenbold erklären zu lassen. Er wisse wohl, was einem Gastwirt passiere, der einem, der auf der Säuferliste steht, auch nur ein einziges Glas einschenke.
Sie werde ihm den Bruder aus den Zähnen rücken, koste es, was es wolle.
Diesem Mädel war alles mögliche zuzutrauen. Schöne Wirtschaft, wenn der Landrat eines Tages zum Gymnasialdirektor sagen würde: „Lieber Freund, es tut mir leid; aber ich habe deinem Bruder die Schankkonzession entziehen müssen.“ Nein, lieber mochte doch der Karl Heinrich nicht mehr kommen. Er kam sowieso schon seit fünf Tagen nicht mehr. Wo steckte er bloß? —
Da war der Gottesdienst aus. Jetzt war’s Zeit. Der Wirt ging nach dem Schanksims, schlug einen Spund in ein mächtiges Faß, brachte es mit dem Kohlensäureapparat in Verbindung, wischte sich die Hände ab und sagte befriedigt: „Fertig!“
Zehn Minuten später war die große Gaststube voll Mannesvolk.
*
Die von weit her waren und darum wohl das meiste Recht gehabt hätten, sich zu stärken, hatten es am eiligsten. Sie schlangen eben nur ein Paar Würstchen hinunter, gossen ein Glas Bier darauf und gingen dann ihrer Wege. Manche hatten weit über eine Stunde bergauf und bergab zu wandern. Am längsten blieben die, die am nächsten wohnten. Sie hatten zwar keine ersichtliche Veranlassung auf ausgiebige Erquickung, aber sie hatten Zeit. Und Zeithaben ist immer ein triftiger Grund zum Trinken.
Als etwa nur noch zehn Männer um den größten Tisch der Wirtsstube saßen, sagte der Schmied dumpf vor sich hin: „Karl Heinrich ist nicht mehr da.“ Sie fuhren alle mit Fragen auf ihn ein, am heftigsten der Wirt.
„Er ist nicht mehr da; er ist nicht mehr in Wiesenthal“, sagte der Schmied, der seinen besten Freund und Zechkumpanen verloren hatte, mit leidumflorter Stimme.
„Er hat’s nicht mehr ausgehalten zu Hause; er ist in die weite Welt!“
„In die weite Welt“, sagten die andern mit Staunen und fast andächtig.
„Woher weißt du es denn? Wie lange ist er fort?“
„Ich weiß es seit gestern. Fünf Tage lang habe ich ihn in allen drei Wirtshäusern gesucht. Er war nicht da. Das hat was Schlimmes zu bedeuten, dachte ich mir gleich. Es konnte ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Da ging ich endlich nach dem Heinrichshofe, um mich zu erkundigen.“
Der Schmied machte eine Pause, sprang auf und schlug auf den Tisch, daß alle Biergläser klirrten und sein eigenes umfiel.
„Ich werd’ es ihr anstreichen! Ich werd’ es ihr geben!“
„Wem?“
„Dem Mädel — der Marie! Ich bin hingegangen, hab’ sie gefragt, wo der Karl sei; da hat sie gesagt:
‚Fortgelaufen ist er! In die weite Welt ist er. Weil er mit euch nicht mehr in der Spelunke sitzen sollte!‘ “
„Spelunke? Spelunke hat sie gesagt?“ fragte der Wirt giftig. „Ich werde sie verklagen.“
„Tue das“, rief der Schmied, „ich verklage sie auch. Gemein ist so was! Ich hab’ nach der Mutter gefragt. Da hat sie gesagt: ‚Die Mutter habt ihr krank gemacht. Den Heinrichshof verwalte ich jetzt.‘ “
„Ah — die versteht’s!“
Nun wurde über Marie Heinrich übel geredet. Man war sich bald darüber einig, daß sie eine Erbschleicherin wäre, die es auf das Gut abgesehen hätte und darum den älteren Bruder aus der Heimat vertrieb. Die Mutter wäre dumm und schwach, da hätte das freche Ding leichtes Spiel. Der Karl sei ein famoser Mensch gewesen, immer lustig, immer gefällig, immer nobel. Wenn er gern einen getrunken habe — Himmel, was sei denn dabei? Karl sei jung und habe es dazu, sich was anzutun. Die Marie habe bis jetzt keinen Mann gekriegt, da wolle sie nun das Gut, damit am Ende doch noch einer anbeißt.
Karl wurde allgemein bedauert. Der Schmied sprang abermals auf, hieb wieder auf den Tisch, wodurch diesmal das Glas des Nachbarn zum Kentern gebracht wurde, und schrie:
„Auch die Arbeit hat sie mir aufgekündigt. Ich meinte, das wäre doch Sache der Frau. Da sagte sie: ‚Die Frau bin jetzt ich, und unsere Schmiedearbeit wird fortan in Bärsdorf gemacht!‘ “
Wieder ging es über Marie Heinrich her. Arbeit, die im Dorf gemacht werden konnte, nach auswärts zu vergeben, galt als großes Unrecht.
Der Schmied verfiel von neuem in seine oft weinerliche Stimmung. Heftig schmerzte es ihn, auf dem größten Hofe des Ortes seine Arbeit zu verlieren, noch dazu nach Bärsdorf hinab, wo nach seiner Meinung die Strandräuber wohnten, die bei der großen Überschwemmung seine Habe aus dem Wasser gefischt hatten. Er trank zwei Gläser Branntwein und wurde immer trübsinniger.
Ein einziger im Kreise hatte dem Geschimpfe still und mit einem leisen Lächeln zugehört, das war der Bauer Erle.
Als nun der Schmied immer wieder über den Verlust seines Freundes klagte, sagte Erle:
„Er ist versoffen wie die Kuckucksuhr des Schmieds. Hat er nicht noch dreimal ganz kläglich: ‚Prosit! Prosit! Prosit!‘ aus der Ferne gerufen? Fortgeschwemmt ist er worden.“
Es wollte ein großer Streit entstehen, aber Erle ließ es nicht darauf ankommen. Er ging. In der Türe drehte er sich noch einmal um:
„Wenn ich auch meine Meinung über Marie Heinrich sagen darf: Sie ist der sauberste Mensch im ganzen Dorfe.“
Bernhard Heinrich war ein stiller, blasser Junge. Er stand im vierzehnten Lebensjahre. Die Kinderkrankheiten: Masern, Scharlach, Diphtheritis hatten ihn sehr mitgenommen und litt seitdem an Kopfschmerzen. Der Pfarrer, ein älterer, freundlicher Herr, gab ihm Unterricht in Latein. Nächste Ostern sollte Bernhard die Aufnahmeprüfung in die Quarta versuchen. Manchmal dachte der Pfarrer mit Sorge: der Junge wird das Studium nicht überstehen. Wenn er’s aber durchmacht, er wird nie ein streitbarer Prediger, ein vielarbeitender Seelsorger, ein Vereinsorganisator oder Kirchenerbauer werden; vielleicht wird er in einen betrachtenden Orden eintreten oder als Klostergeistlicher sein Leben verbringen.
Es war erklärlich, daß sich der kecke, gesunde Klaus und der zarte, fromme Bernhard nicht gut vertrugen. Bei allen Streitigkeiten aber trug Bernhard den Sieg davon, denn der muntere Junge griff mutig an, der blasse verteidigte sich kaum. So machte der Kampf keinen Spaß. Bei solchen Gelegenheiten wurde die Rede des Klaus immer heftiger, die des Bernhard immer sanfter, immer leiser, so daß Klaus schließlich den Streit aufgab und als Geschlagener von dannen schlich. Manchmal schalt er über die zu große Sanftmut des Bruders. Gewöhnlich redete er sich ein, daß er Bernhard als einen jämmerlichen Leisetreter gründlich verachte; dann wieder entdeckte er in sich eine geheime, scheue Hochachtung vor dem jungen Lateiner. Er, Klaus, war nun zwölf Jahre alt. Es fiel dem Pfarrer gar nicht ein, auch ihm lateinische Stunden zu geben. „Lerne du erst besser den Katechismus!“ hatte er gesagt. Auf der einen Seite fand Klaus das Ausbleiben des lateinischen Unterrichts als eine ihm persönlich angetane Unbill und Zurücksetzung, auf der andern freute er sich, daß er nicht zur „Stunde“ mußte wie der Bruder. Einmal hatte er das Latein buch des Bruders erwischt und die erste Lektion aufgeschlagen: Asia est terra, Europa est terra. Asia et Europa sunt terrae. Das fand er leicht. Asia und Europa übersetzte er fließend, „est“ stellte er ohne weiteres als „ist“ und hinter „sunt“ witterte er richtig „sind“. Aber „Terra“ machte Schwierigkeiten. Klaus kannte von ähnlichen Wörtern nur „Terrine“, die Suppenschüssel, und „Terrier“, den weiß und schwarz gezeichneten Hund. Wahrscheinlich hieß es: In Asien und Europa sind Suppenschüsseln und weiße Hunde mit schwarzen Flecken. Er sagte das dem Bruder, und Bernhard lachte. Er lachte wirklich einmal laut, der Leisetreter. Aber schon reute den Frommen dieses Lachen, und er belehrte den Bruder, daß „terra“ „Land“ bedeute. „Europa ist ein Land, Europa und Asien sind Länder.“ Klaus genierte sich mit seiner Suppenschüssel- und Hundeübersetzung und rannte vor den vielen Schwierigkeiten der lateinischen Sprache davon.
Читать дальше