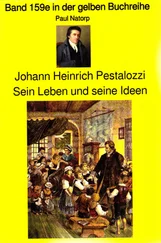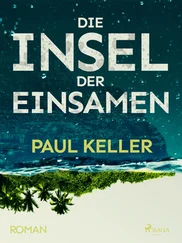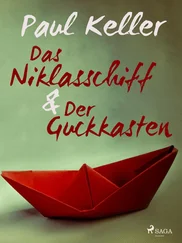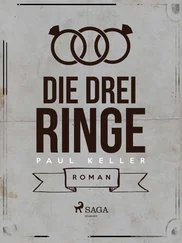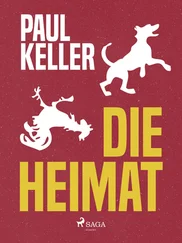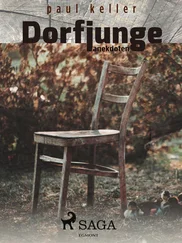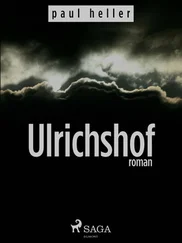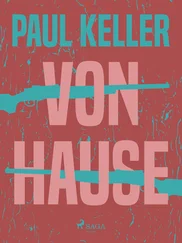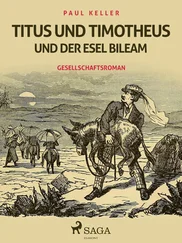Sie ließ ihn los. Er lief mit einer wüsten Drohung aus der Stube.
*
Drei Tage später fuhr Marie mit der Mutter nach der Kreisstadt. Sie selbst lenkte den Einspänner. In der Stadt gingen die beiden Frauen zu einem Notar. Dort machte die Mutter ihr Testament und stellte ihrer Tochter Marie eine Generalvollmacht aus für die Verwaltung des Gutes. Das alles regte die alte Frau sehr auf. Marie brachte sie deshalb in ein Gasthaus, setzte sie in eine Sofaecke, bestellte Kaffee für sie und ging allein wieder nach der Stadt. Sie besuchte ein Bankhaus, machte einige kleine Besorgungen und kaufte zum Schluß eine schwere, eiserne Geldkassette, die an den Fußboden anzuschrauben ging.
Dann fuhren sie schweigend nach Hause. Lang dehnte sich der Weg zwischen Erlen und Wiesen. Schwere Gedanken waren in den Köpfen der Frauen. Endlich sagte die Mutter:
„So wäre ich also jetzt fertig mit dem Leben. Das Testament ist gemacht! Dir ist alles übergeben.“
„Reut es dich, Mutter?“
„Nein, es muß ja so sein. Du wirst es schon schaffen, Marie.“
Das Rößlein schlich langsam den Weg entlang. Marie saß neben der Mutter und kutschierte. Zwischen ihnen auf dem Fußboden stand hochgekantet die schwere Stahlkassette und beengte den Platz.
„Warum hast du den eisernen Kasten gekauft, Marie? Es hat uns noch niemals jemand bestohlen.“
„Man kann nie wissen, was kommt.“
„Ach, Marie, hast du denn etwa einen Verdacht auf Karl? Er ist liederlich und viel im Wirtshaus. Aber er ist doch kein Dieb.“
„Man kann nie wissen, was kommt“, wiederholte das Mädchen.
Sie ließ das Pferd unbeachtet und wandte sich zur Mutter.
„Wir müssen Herr werden über ihn. Die letzten Schulden, die er in unseren drei Wirtshäusern gemacht hat, habe ich bezahlt und den Wirten gesagt, daß nicht mehr ein Pfennig von uns gegeben wird. Borgen sie ihm wieder, so ist es ihr Schaden.
„Sie werden sehr böse sein auf dich.“
„Ja, sie sind böse. Aber daran schere ich mich nicht. Ich werde dem Karl drei Mark Wochenlohn geben. Er verdient noch gar nicht so viel. Die drei Mark wird er Sonnabend, wenn er sie bekommt, vertrinken; dann wird er eine Woche lang nüchtern bleiben müssen; denn es wird ihm niemand borgen, und ich werde nicht einen Pfennig mehr an ihn abgeben. Ich hab’ ihm gestern das alles gesagt.“
„Du bist zu hart gegen Karl.“
„Nein, ich bin nicht zu hart, sondern du warst zu weich. Das wird nun anders.“
Die alte Frau weinte still vor sich hin.
„Waren es denn viele Schulden?“
„Ja, es war viel.“
„Wieviel denn?“
„Das möchte ich nicht sagen. Die Schulden mußten bezahlt werden, und sie sind bezahlt.“
*
So kamen sie nach Hause. Da zeigte es sich, daß die hölzerne Truhe, in der bis jetzt im Heinrichshofe das Geld aufbewahrt wurde, erbrochen und beraubt war. In der Truhe lag ein Blatt, mit Bleistift beschrieben. Karl teilte mit, er halte es zu Hause nicht mehr aus, er lasse sich von einem Frauenzimmer, das zwei Jahre jünger sei als er, nichts sagen; er sei gegangen und habe die paar Groschen, die in der Truhe gewesen seien, als Reisegeld mitgenommen. Aber er verzichte auf nichts; er werde wiederkommen und sein Recht als Ältester fordern.
Marie entdeckte den Einbruch zuerst. Die Lade stand in einer Oberstube; niemand von den Dienstleuten hatte etwas von dem Diebstahl bemerkt. Karl hatte sich gegen Mittag entfernt; ein Dienst junge hatte ihm auf einem Schubkarren einen Koffer zum Bahnhofe fahren müssen. Marie schloß die Lade, nahm den Meißel, mit dem sie erbrochen war, und legte ihn unten in den Handwerkskasten zurück. Dann suchte sie Wilhelm auf und fragte ihn, was er über Karl wüßte. Wilhelm war auf dem Felde gewesen, als er aber von Karls Weggang erfuhr, ahnte er, daß da etwas nicht in Ordnung wäre, er ging nach dem kleinen Lokalbahnhof und erfuhr, daß Karl eine Fahrkarte nach Breslau gelöst hatte.
„Nun“, sagte Marie mit ruhigklingender Stimme, „so werden wir ihn reisen lassen müssen.“
Als sie nun aber doch der Mutter mitteilen mußte, was vorgefallen war, bedurfte es all ihrer Willenskraft, die äußere Ruhe zu bewahren.
Die Mutter lag mit Kopfkrämpfen im Bett. Marie saß bei ihr, flößte ihr Baldriantee ein, machte kühle Umschläge, saß dann wieder still da und hielt die Hand der leidenden Frau.
„War viel Geld in der Truhe?“ fragte die Mutter.
„Nein! Vorgestern war viel drin, das Kaufgeld für den Ochsen und die zwei Schweine und alles Gesparte vom Vierteljahr. Aber ich habe gestern bei den Wirten die Schulden bezahlt, und alles andere, was wir nicht brauchen, heute auf der Bank eingezahlt. Es waren knapp hundert Mark da.“
„Hast du es denn geahnt, Marie?“
„Ja!“
„O Gott — o Gott — ein Dieb!“
Das Mädchen legte die kühle Hand auf das zuckende Haupt der Mutter und bat sie, nicht mehr davon zu reden, sondern zu versuchen, ein wenig zu ruhen. Die Frau wurde stiller, die Müdigkeit machte sie still. Aber dann schlug sie die Augen auf und fragte:
„Marie, in der Truhe war auch dein goldenes Kreuz und dein Granatarmband. Hat er das auch mitgenommen?“
Das Mädchen zögerte mit der Antwort, dann sagte sie:
„Ja, das Kreuz und das Armband hat er auch mitgenommen. Aber er wird nicht viel dafür kriegen, und ich brauche keinen Schmuck. Ich fürchte, er wird bald wieder da sein.“
Die Mutter weinte lange in ihr Kissen. Dann sagte sie:
„Marie, ich hoffe, daß er bald zurückkommen wird oder Nachricht gibt. Für eine Mutter ist es schrecklich, wenn sie von einem Kinde nicht weiß, wo es ist.“
„Ja, Mutter, ich weiß es.“
Im Dorfe waren drei Wirtshäuser. Das größte davon stand neben der Kirche, wie sich ja meist Bacchus sein fröhliches Zelt oder Merkur seinen bunten Jahrmarkt neben dem ernsten Haus des Christengottes aufschlagen. Der dicke Gastwirt musterte das Gelände. Es war alles in Ordnung. Der Fußboden war gestern am Sonnabend frisch gescheuert und mit Sand bestreut, Bänke und Tische waren abgestaubt worden; die Schnapsflaschen standen in Reih und Glied, das Fliegenpapier war erneuert, der Uhrzeiger um zwanzig Minuten zurückgedreht, in der Küche warteten fünfzig Paar Wiener Würstchen auf ihre Konsumenten. Das Faß Bier wollte der Wirt erst anschlagen, wenn sie drüben in der Kirche: „Dona nobis pacem“ singen würden. Dann war’s aus, dann kamen sie.
Es dauerte noch eine Weile. Der Wirt sah ein Bild an, das an der Wand hing. Es stellte eine rote Rose dar, und rund um die Rose stand in blauen Buchstaben gemalt: „Die Rose blüht, der Dorn, der sticht; wer gleich bezahlt, vergißt es nicht.“ Diese poetische Mahnung hing den Zechern immer vor der Nase. Wer kein Geld hatte, zahlte trotzdem nicht. Karl Heinrich hatte zweihundertundfünfzig Mark Schulden bei ihm gehabt. Die waren nun bezahlt; aber der Wirt hatte keine rechte Freude. Marie Heinrich war plötzlich bei ihm aufgetaucht mit dem Gelde und hatte eine Strafpredigt gehalten, schlimmer als der Pfarrer an Silvester. Er hatte sich verteidigt und gesagt, er gäbe als braver Wirt den Gästen das, was sie bestellten; er nötige niemandem etwas auf, aber die Wünsche der Gäste müßte er erfüllen. Sie hatte immer weiter auf ihn eingeredet. Was sich so ein junges Ding herausnahm gegen einen Ehrenmann! Schließlich war die Marie so laut geworden, daß die Wirtsfrau erschienen war und gefragt hatte, was denn los wäre. Da hatte Marie die ganze Strafpredigt noch einmal gehalten und am Schluß zur Frau gesagt: „Frau Erkner, Sie haben Kinder, ich wünsche Ihnen, daß Gott die Sünden Ihres Mannes nicht an Ihren Kindern strafe und eines so herunterkommen lasse, wie unser Karl hier bei Ihnen heruntergekommen ist.“
So eine! Lieber wollte der Wirt sogar eine Silvesteroder Fastenpredigt mit anhören, als ihr noch einmal in die Hände fallen. Bei solchen Predigten in der Kirche, die dem Wirt schrecklich auf die Nerven fielen, wurde es einem aber doch nicht so persönlich, nicht so ins Gesicht hinein gesagt, wie es dieses dumme Ding sich erdreistet hatte.
Читать дальше