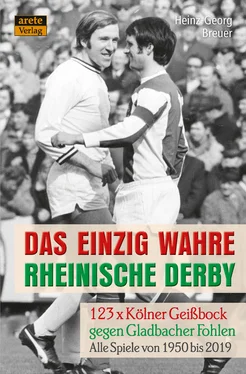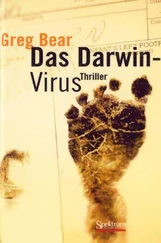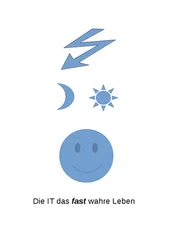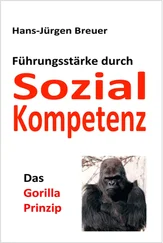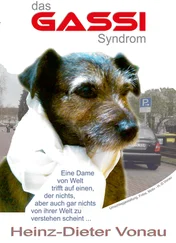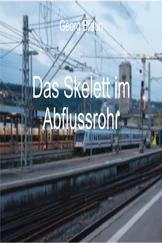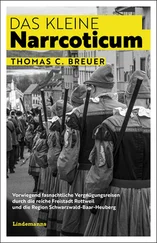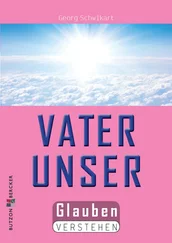Eine Ausnahme macht der Direktor des Schweizerischen Sozialarchivs, Prof. Dr. Christian Koller. Sein Beitrag „Das Derby – traditionelle sportliche Rivalitäten innerhalb und zwischen Städten“ beim Südwestdeutschen Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung wird 2008 veröffentlicht. Koller greift die etymologische Unsicherheit zur Herkunft des Begriffs auf und versteht Derbys einmal als Wettstreit zwischen Quartieren einer Stadt und zum anderen als Konfrontation mit Fremden. Auf Fußballklubs bezogen ist für ihn sportliche Konkurrenz auf Augenhöhe die „notwendige Voraussetzung“. Ähnlich der Sozialwissenschaftler Hartmut Hering aus Gelsenkirchen 2016 im „Deutschlandfunk“. Hering ist 2002 Herausgeber des Buch-Klassikers „Im Land der tausend Derbys. Die Fußball-Geschichte des Ruhrgebiets“. In einer „FAZ“-Rezension von damals heißt es: „Eine gewisse räumliche Nähe ist notwendig für ein Derby, aber sie reicht nicht aus. Dem Publizisten Hartmut Hering ist zuzustimmen, wenn er sagt, es müsse eine Geschichte dahinterstehen, damit aus einem Nachbarschaftsduell ein Derby werde.“
Der Schweizer Koller unterscheidet zwischen Derbys in einer Stadt mit den Varianten „Zweiverein“ und „Vielverein“ sowie Derbys zwischen Vereinen verschiedener Städte. Auch hier: Eine bloße örtliche Zuordnung reicht nicht automatisch. Laut Koller sind vielmehr die Rivalen zusätzlich mit Eigenschaften belegt, „die über die rein topographische Abgrenzung der Einzugsgebiete ihrer Anhängerschaft hinausreichen“. Ähnlich die Argumentation bei Partien zwischen Vereinen aus einander fremden Städten. Koller benennt als Derbys Spiele zwischen Klubs derselben Region (also eine strukturelle Erweiterung der Stadtderbys) sowie Spiele, denen „aus sportlichen oder außersportlichen Gründen traditionellerweise eine besondere Brisanz innewohnt“. Das wirkt nur bedingt präzise. Immerhin stellt Koller fest, dass es bei den Fremdpartien um Spiele geht, die erst dann einen Derby-Status bekommen, wenn gewisse Rivalitätsmuster vorher da sind. Zugleich geht mit dem Traditionen-Element einher, dass Derbys erkennbar Nachhaltigkeit haben müssen.
Legt man eine strenge Elle an, dann ebnet sich Kollers Systematik am Ende ein auf Spiele über einen längeren Zeitraum zwischen zwei gleich starken Klubs, die meist (aber eben nicht immer) benachbarte Standorte haben, immer aber über die vordergründige sportliche Konkurrenz hinaus eine besondere Rivalität zueinander besitzen.

Derby-Forscher: Der Züricher Uni-Professor Dr. Christian Koller, Direktor des Schweizerischen Sozialarchivs. Foto: Privat
Auf dieser Basis lässt sich arbeiten. Dass Köln und Mönchengladbach einander fremde Gebietskörperschaften sind, ist nicht bestreitbar. Aber sie liegen doch jedenfalls in einer Region, im Rheinland? Hier kommen nun flink die ideologischen Erbsenzähler ins Spiel: Das Duell sei ja gar kein echtes rheinisches Derby, weil Gladbach nicht direkt am Rhein liege. Und damit können sie auch keine Rivalen sein, weil das aus dem Lateinischen („rivalis“) abgeleitet sei und jemanden bezeichnet, der bei der Nutzung eines Wasserlaufs eine Mitberechtigung hat … Umgekehrt wird ein (Fußball-)Schuh draus: Wem würde es wohl einfallen, den Rhein-Anrainer FSV Mainz 05 als Partner im Rheinischen Derby zu benennen?
Die kleinmütigen Bedenken treffen so oder ähnlich auch bei anderen Borussen-Derbys von einst und jetzt zu: die Niederrhein-Derbys gegen Fortuna Düsseldorf, den MSV Duisburg, vorher Meidericher SV, und Bayer Uerdingen. Oder das Grenzland-Derby gegen Alemannia Aachen. Nicht zu vergessen das Derby gegen den Rheydter Spielverein in den beiden nach dem Krieg noch (bzw. wieder) getrennten Städten. Original-Ton Borussia-Chronik: „Keine fünf Kilometer trennten Borussias langjährige Heimat, den Bökelberg, vom Zuhause des ‚Spö‘, wie die Rheydter Fußballfreunde ihren Spielverein liebevoll nennen.“ An hautnahen Vor-Ort-Duellen haben auch die Kölner von Beginn an reichlich – die Fortuna in der Südstadt etwa. Oder die rechtsrheinische Viktoria, vorher Preußen Dellbrück, innerhalb der eigenen Stadtmauern. Oder Bayer Leverkusen an der Stadtgrenze.
Es hat in der Nachkriegs-Fußballgeschichte eine Spielzeit gegeben, in der Kölner und Gladbacher die Rekordzahl von sieben (!) Rheinland-Duellen in einer höchsten deutschen Spielklasse absolvieren: 1953/54. In meinem Geburtsjahr sind in der Oberliga West neben den beiden weiterhin Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Alemannia Aachen, der Meidericher SV, der Rheydter Spielverein und Preußen Dellbrück versammelt. Von späteren Bundesligisten fehlen nur Rot-Weiß Oberhausen, 1951 aus der Oberliga abgestiegen, Fortuna Köln, 1952 aus der 2. Liga West abgestiegen, und Bayer 05 Uerdingen, das erst im Jahr 1953 mit den Werkssportabteilungen des Chemie-Konzerns fusioniert.
Eine Rarität schaffen die Kölner allein: Im Jahr 1983 spielen der FC und Fortuna Köln das bisher einzige Stadtduell in einem DFB-Pokalendspiel (1:0). Wo? Im Müngersdorfer Stadion.

Die Nationalspieler Helmut Rahn (l.) und Albert Brülls beim Derby an Karneval 1960 in der „Kull“. Foto: Imago/Krschak
II. Erklärungsversuche von Böll bis Berlusconi
Derbys in aller Welt sind kein Muster für das Rheinland
Das empirische Derby-Loch scheint sich herumgesprochen zu haben. Vermehrt finden sich Master- oder Diplom-Arbeiten zumindest punktuell zum Thema. Ein Beispiel ist 2011 die Diplom-Arbeit von Mirko Twardy (Universität Bonn) zum Einfluss eines Bundesligisten auf regionale Identität am Beispiel von Bayer Leverkusen (auch in Abgrenzung vom 1. FC Köln). Außerhalb der Wissenschaft versucht die Plattform „ footballderbies.com“ einen auf dem Schweizer Koller aufbauenden Ansatz. Die englischsprachige Website unterteilt in „City Derbies“, „Local Derbies“ und „Rivalries“, also gewachsene Rivalitäten.
Die räumliche Nähe funktioniert wie gesagt nur bedingt. So kann man damit allein nicht erklären, warum etwa Gladbach gegen Köln (46 km Entfernung Luftlinie, 60 km über die Straße) so viel mehr Derby-Charakter beigemessen wird als Duisburg gegen Schalke (25 km). Doch wenn gar die Paarung HSV – Bayern ein „Nord-Süd-Derby“ ist, wie man oft genug in den Medien lesen und hören kann, dann hat das bei 600 Kilometern Entfernung zwischen den Klubs weder mit lokal noch mit regional etwas zu tun.
Auch wenn ein Kilometer ein Kilometer ist und eine Meile eine Meile bleibt – das Raummaß wirkt rund um den Erdball unterschiedlich. Dens Park und Tannadice Park, die Stadien der schottischen Premiership-Klubs FC Dundee und Dundee United, trennen 300 Meter Luftlinie, über die Straße sind es 700. Eindeutig, auch weil es keine Phrase, sondern im Wortsinne ein Duell um die Position des Platzhirschs ist: Derby! Die Spielstätten des VfL Osnabrück und der Sportfreunde Lotte sind auch nur zehn Kilometer voneinander entfernt, liegen aber in zwei Bundesländern – Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Derby? Bei ungleicher sportlicher Historie wohl fragwürdig. Eventuell, wenn man sinnfrei berücksichtigt, dass seit 1976 Osnabrück Partnerstadt des englischen Derby ist …
Bleibt die Rivalität, die sich unterschiedlich ausbilden kann. Naheliegende Begründung im Wortsinne ist nach wie vor die direkte Nachbarschaft mit der Frage, wer „Herr im eigenen Hause“ ist. Das ist seit 2010 mit der „Psychologie der Rivalität“ der US-Professoren Gavin J. Kilduff, Hillary A. Elfenbein und Barry M. Staw die erforschte Faktenlage: „Konkret argumentieren wir, dass die Beziehungen zwischen Wettbewerbern, die durch ihre Nähe, Attribute und frühere Interaktionen bestimmt werden, die subjektive Intensität der Rivalität zwischen ihnen beeinflussen.“
Читать дальше