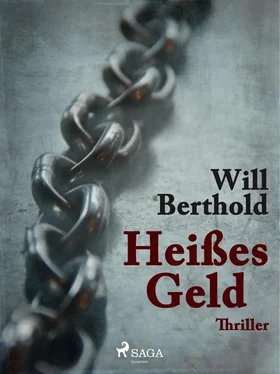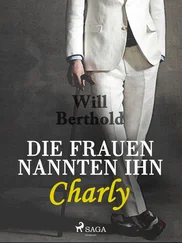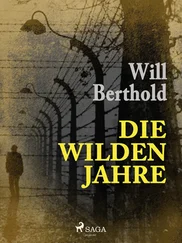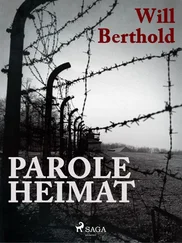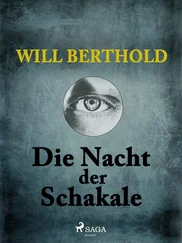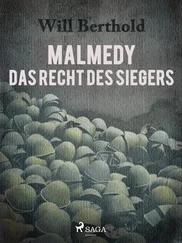»So ungefähr.«
Der alte Roskoe sah einen Moment zum Autofenster hinaus. »Miriam Greenstone war schwer herzkrank gewesen. – Ihr Mann hat die Zusammenhänge geahnt, aber nicht gewagt, sie ganz aufzuklären.«
»Die Geschehnisse liegen doch an die 20 Jahre zurück?«
»Ja.«
»Und es ist bisher nichts in der Sache unternommen worden?«
»Doch, es ist viel unternommen worden.« Der Senior Jächelte bitter. »Es ist bloß – soviel ich weiß – wenig geschehen.«
Feller sagte nichts; es war eine Antwort.
»Für mein Rechtsgefühl ist es einfach unerträglich, daß hier Mörder gewissermaßen über den Gräbern ihrer Opfer die erpreßte Millionenbeute genießen, das Blutgeld für ein Verbrechen, an dem eine ganze Familie zugrunde gegangen ist.«
»Aber der alte Greenstone wollte doch an diese Dinge nicht mehr rühren«, erwiderte Feller behutsam.
»Nicht er hat Nathans Brief bekommen, sondern wir«, entgegnete der Alte mit leichter Schärfe.
Feller nickte, er war weder störrisch noch begriffsstutzig, ein blendender Jurist, ein Pragmatiker, kein Theoretiker. Als Gegenanwalt Roskoes hatte er in einem Zivilverfahren dem Alten schwer zugesetzt, und es war bezeichnend für den Senior gewesen, daß er Feller später als Kronprinzen in seine Firma berief, da – wie er grinsend festgestellt hatte – »die Spitzenstellung von Brown, Spencer & Roskoe darauf basiere, daß sich die Kanzlei seit 90 Jahren durch Adoption fortpflanze«.
Henry W. Feller stammte aus dem Mittelwesten. Er war der Sohn deutscher Einwanderer, die aus Dortmund in die Staaten gekommen waren und sich in Milwaukee niedergelassen hatten, wo bekanntlich Milch und Bier fließen. Bereits vier Monate nach ihrer Einbürgerung war ihr einziger Sohn Henry zur Welt gekommen, und als im Land geborener Amerikaner hätte er nunmehr sogar US-Präsident werden können. Fellers Ziele waren jedoch bescheidener.
»Und was können wir unternehmen?« fragte er.
»Zunächst einmal die Zusammenhänge aufklären.«
»My god – nach 20 Jahren?«
»19«, erwiderte der alte Roskoe.
»Sehr ehrenwert«, entgegnete Feller und lächelte ein wenig resignant. »Und sehr romantisch.« Er betrachtete einen Moment seine Schuhspitzen. »Ich fürchte, wir Juristen werden das Unrecht so wenig aus der Welt schaffen wie die Mediziner den Tod.«
»Keine Philosophie, Henry«, sagte der Senior. »Sie werden jetzt gleich auf dem Schreibtisch in Ihrem Büro Nathans Brief finden. Zunächst verlange ich von Ihnen nicht mehr, als daß Sie ihn lesen.«
Sie hatten die Fifth Avenue erreicht und stiegen, bevor der Fahrer die schwere Mercedes-Limousine in die Tiefgarage zur 53. Straße brachte, aus. Sie fuhren im Lift hoch, erreichten die noble Kanzlei, in der es keine unechten Orientteppiche, keine falschen Antiquitäten und keine leeren Worte gab. Nach einem geflügelten Wort, das der Senior durchaus ernst nahm, suchten sich Brown, Spencer & Roskoe ihre Klienten aus und nicht diese ihre Anwaltsfirma.
»See you later«, verabschiedete Roskoe seinen Mitarbeiter.
Gleich bei Betreten seines Büros sah Feller in einem verschlossenen Umschlag auf seinem Schreibtisch die Unterlagen, die ihm sein Förderer angekündigt hatte. Er wußte, daß ihm der Tag nichts schenken würde, und griff nach dem Begleitbrief der texanischen Anwälte, die darum baten, ihnen die Übergabe des Schreibens ihres im März 45 gefallenen Klienten Nathan Greenstone zu bestätigen und »alles Nötige und Mögliche veranlassen zu wollen«. Der Anwalt griff nach dem Hauptschreiben.
Bevor er sein Jurastudium an der Harvard University als Zweitbester seiner Crew absolviert hatte, war er als Leutnant in einem der Eliteregimenter des Panzergenerals Patton von der Normandie bis zur deutschen Grenze gestürmt. Während die Kämpfe im Reichswald bei Aachen tobten, versetzte man den Offizier – der zweisprachig aufgewachsen war – zu einer Spezialeinheit für psychologische Kriegführung. Automatisch landete Feller dann in der Besatzungszeit für zweieinhalb Jahre beim US-Geheimdienst. Aus der Zeit beim »Counter Intelligence Corps« in Frankfurt waren ihm Beziehungen und Erfahrungen geblieben, die sich ihm eingebrannt hatten, und so könnte ihn – wie er annahm – ein über Deutschland abgeschossener Bomberpilot kaum mit etwas Neuem überraschen.
Er nahm den Brief zur Hand und erfaßte als erstes, daß der alte Greenstone doch erheblich länger gelebt haben mußte, als sein jüngster Sohn bei der Niederschrift des Briefes, der zu einem Vermächtnis werden sollte, Ende 44 angenommen hatte.
»Ich werde morgen mit meinem Geschwader nach Italien verlegt, um von dort aus Einsätze über Deutschland zu fliegen. Für den Fall, daß mir dabei etwas zustoßen sollte, möchte ich meine Aussage über einige Vorgänge in Paris festhalten, die in direktem Zusammenhang mit dem Tod meines Bruders Joseph stehen. Ich bin bereit zu beschwören, daß es sich bei meinem Bericht um die reine Wahrheit handelt.
Ich hatte mich 1940 in Frankreich aufgehalten, um mich in Vertretung meines Vaters um unsere französische Zweigniederlassung zu kümmern. Als sich die deutschen Truppen Paris näherten, flüchtete ich aus der französischen Hauptstadt nach Süden und gelangte mit vielen anderen in den zunächst unbesetzten Teil Frankreichs. Ich war 24 Jahre alt, hatte bereits die amerikanische Staatsbürgerschaft und sprach – da ich in Berlin aufgewachsen war – fließend deutsch, weshalb ich den Maquisards der Résistance gelegentlich behilflich sein konnte. Gleichzeitig versuchte ich, unsere Besitzungen in Südfrankreich zu verkaufen, bevor sie die Nazis enteignen konnten. Im Norden war die Registrierung der jüdischen Bevölkerung und Firmen bereits angeordnet; es schien nur eine Frage der Zeit, bis sich die Vichy-Regierung den Verfolgungen im besetzten Frankreich anschließen würde.
Freunde, bei denen ich mich versteckt hielt, warnten mich davor, daß Hitlers Truppen bald den Doubs überschreiten und auch den unbesetzten Teil Frankreichs okkupieren würden. Ich wollte mich nach Portugal durchschlagen und wartete auf eine Gelegenheit, doch meine Abreise verzögerte sich immer wieder. Ich wurde denunziert und fiel in die Hände der Leute, die mich aus Deutschland vertrieben hatten. Ich wurde mißhandelt und mit anderen Leidensgefährten zusammen in das berüchtigte Lager Drancy geschafft, um von hier aus mit einem Sammeltransport per Viehwagen in den Osten › verschubt‹ zu werden. Ich machte mir keine Illusionen über unser weiteres Schicksal und tröstete mich, daß wenigstens Joseph das Furchtbare erspart bliebe. Ich hatte vor meiner Abreise gehört, daß er sich als Soldat freiwillig zur Army gemeldet hatte. Das gleiche hatte ich vorgehabt, aber nun war es zu spät.
Es blieb uns nur die Hoffnung, darauf zu setzen, daß sich der Transport so lange verzögerte, bis wir eine Fluchtmöglichkeit gefunden hätten. Ein-oder zweimal gelang es mir, der wahllosen Verladung in die Waggons zu entkommen, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis ich das Schicksal der anderen teilte.
Ende 43 erschienen einige Offiziere der SIPO im Stab des Höheren SS- und Polizeiführers von Paris, um uns zu vernehmen. Ich berief mich darauf, daß ich Amerikaner sei, und stellte fest, daß sich der Obersturmführer Dumbsky – wie sich bald herausstellte, unter den Vernehmern für die subtileren Verhörmethoden zuständig – mehr für unsere Firma in New York interessierte als für meine Tätigkeit in Frankreich.
Ich wurde von meinen Schicksalsgefährten getrennt und in eine Art Privatgefängnis in der Nähe des Boulevard Lannes gebracht, wo die Gestapo während der Besatzungszeit ihre feudalen Quartiere bezogen hatte. Ich kam mit anderen Gefangenen zusammen und erfuhr, daß wir uns nunmehr in den Händen einer zivilen Firma, der Dewako, befänden, die im neutralen Ausland dringend benötigte Rohstoffe für die deutsche Rüstung besorgte. Dafür brauchte sie Devisen, und zwar in erster Linie Dollars, und so war die tatsächliche Handelsware dieses ›Deutschen Warenkontors‹ die Erpressung in ihrer übelsten Form:
Читать дальше