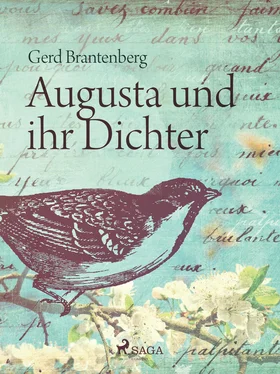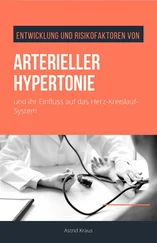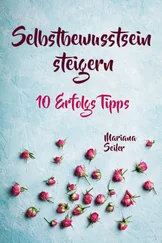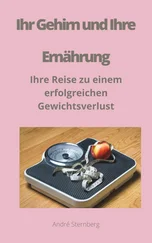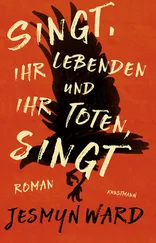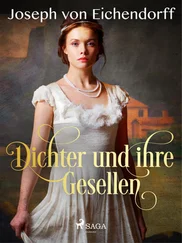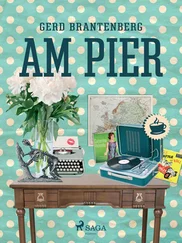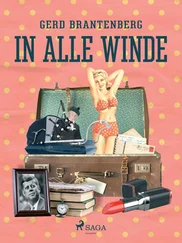Er endete in einer Schankstube und hatte bald eine Frau auf den Knien hängen, er wußte, daß jemand sie gestoßen hatte. Sie bat um Entschuldigung, blieb aber sitzen, und als er ihre Wärme und ihren weichen Körper an seinem spürte, erwachte seine Lust, und er ging mit ihr in ein Zimmer oben im Laubengang. Er gehorchte dem Befehl seines Körpers, und alles war gut. Aber als die Frau danach sagte, sie sei achtzehn Jahre alt, schämte er sich. Er hatte sie für über dreißig gehalten, für etwas jünger als sich selber. Sie erzählte ihm ihre Geschichte. Darin kam alles vor, was ein Leben zerstören kann. Ihr Vater war unbekannt, ihre Mutter im Kindbett gestorben. Die Frau war zu einer Tante gegeben worden. Die Tante schlug sie jeden Tag und nannte sie häßlich, weil sie ihrem Vater ähnlich sah. Der Onkel vergewaltigte sie. Sie verliebte sich in einen Jungen vom Nachbarhof und wurde schwanger. Sie waren zwar verlobt, aber der Junge setzte sich ab und ging zur See. Sie mußte vor der Schande davonlaufen, gebar ihr Kind in aller Heimlichkeit, es starb, und nun saß sie hier.
Ich muß dieses Mädchen mit nach Oppdal nehmen, dachte Jon Mjøen. Alles hat seine Geschichte. Alle Menschen haben ihre Geschichte. Manchmal ist es besser, diese Geschichte nicht zu kennen. Sie zerreißt uns sonst das Herz. Elise hieß das Mädchen. Er ging wieder zu ihr. Und sie gewann ihn lieb.
Jon Mjøen bestand sein Examen, noch dazu mit den besten Noten. Jetzt war er fertiger Jurist, und Helene wurde fortan „gnädige Frau“ genannt. Als sie wieder gen Norden aufbrachen, wußte man das schon auf sämtlichen Posthaltereien und Höfen der ganzen Strecke – bei Lensmann Kaasen in Eidsvold, beim alten Gudbrand in Ringebu, in Laurgård, Dovre, Hauen, bei Iver Tofte auf Toftemoen, in Dombås, in der Fokstue, in Hjerkinn und Kongsvoll. Überall wurden sie herzlich aufgenommen und beglückwünscht, nirgends mußten sie bezahlen. Und in einer Bruchbude in einer Gasse, auf der die Abwässer frei herumschwammen, hoffte eine Frau, daß der Trønder mit dem guten Herzen zurückkommen und ihr helfen würde, wie er es versprochen hatte.
Eines Tages kamen die Gerüchte, daß im Kielwasser der Lensmannsgattin Gegenstände verschwanden, auch dem Lensmann zu Ohren. Ein Dorftrottel im Laden hatte sich verraten, er hatte einen über den Durst getrunken. Der Lensmann stellte seine Frau sofort zur Rede. Wußte sie, was über sie behauptet wurde? Nein, sie hatte keine Ahnung, sie hatte nie viel mit der Dorfbevölkerung zu tun gehabt, und es interessierte sie auch nicht weiter, was die sich so dachte. Gemocht hatten sie sie ja noch nie. Ihr Mann sagte nichts mehr. Aber eines Tages kaum ein Bauer aus Aune und sagte, aus seiner Truhe seien zehn Taler verschwunden, und zwar just an dem Tag, als Frau Mjøen Eier abgeliefert habe. Gleich neben der Truhe habe man ein mit den Buchstaben „H. P. S.“ besticktes Spitzentaschentuch gefunden. Stand auf so etwas keine Strafe? Das müsse der Lensmann ja am besten wissen, meinte der Bauer. Jon Mjøen war wütend und sagte, er wolle solches Gerede nicht hören, und ein Spitzentaschentuch sei kein Beweis. Sie könne das überall verloren und jemand könne es neben die Truhe gelegt haben. Aber am nächsten Tag suchte er den Bauern auf und gab ihm zehn Taler. Er sagte, er könne auf diese Summe besser verzichten als der Bauer, der jedoch solle im Gegenzug dafür sorgen, daß seine Leute nicht mehr über die Sache sprachen.
Das Gegenteil passierte. Als sich die Nachricht verbreitete, daß der Lensmann bezahlt hatte, war die Stimmung ganz oben. Jetzt konnten alle zugreifen. Sie brauchten dem Lensmann nur jeden Diebstahl zu melden, der sich im Ort zutrug, und schon würde er bezahlen, um seine Frau zu schützen.
Jon merkte schließlich, wie seine Reaktion ausgelegt worden war, und bat Gott, den anderen Erleuchtung zu schenken. Dann ging er zu seiner Frau und sagte: „Ich fürchte, du mußt mir deine Verstecke und Fächer zeigen.“ Er wußte nämlich kaum noch, was er denken sollte. Und er hatte Angst vor ihrem Zorn.
Und das zu Recht. Sie steigerte sich in eine Wut, die ihre Familienähnlichkeit mit Peder Bjørnson mehr als deutlich werden ließ, und sagte, sie hätte nie gedacht, daß es soweit kommen könnte und daß er ihr dermaßen mißtrauen würde. Und übrigens habe er kein Recht, das Wohnhaus zu durchsuchen. „Als dein Mann habe ich das nicht“, erwiderte er. „Als Lensmann wohl.“ Sie preßte die Lippen aufeinander und führte ihn zur Erbtruhe, in der sie ihre Schätze aufbewahrte.
Es war eine alte Eichenholzkiste mit gewölbtem Deckel und Eisenbeschlägen, in die die Jahreszahl 1712 eingestanzt war. Die Truhe hatte zu Helenes Aussteuer gehört, sie stammte von ihrem Großvater. Sie zog die Schlüssel hervor und öffnete. In der Truhe gab es kein Geld.
„Ja, ja, das kann natürlich auch anderswo sein. Vielleicht solltest du im Vorratshaus zwischen den Würsten nachsehen?“ schlug sie vor.
Mehr passierte nicht. Er wußte, daß er ebensogut ein Feuer mit Luft löschen wie versuchen könnte, ein Gerücht zum Verstummen zu bringen. Eine kleine Flamme mochte vielleicht erlöschen, eine große wurde nur noch größer. Und wenn die Gerüchte doch zutrafen? Und wie sah es wohl in Helenes Seele aus? Er fiel auf die Knie und faltete die Hände zum Gebet, aber das Gebet wollte sich nicht einstellen. Ihm fiel ein Bibelwort ein: „Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.“ Er schaute in sich hinein.
„Und vergib uns unsere Schuld“ wurde jeden Sonntag in der Kirche gebetet. Es war so leicht, das zu sagen. Schwieriger war es, tiefer zu gehen. Vergib mir, daß ich geschlagen, gestohlen, meine Ehefrau betrogen habe! Das alles hatte er getan, das wußte er, wenn er sein Leben seit seiner Kindheit durchging. Er hatte den Herrn und seine Eltern verflucht und Mordgedanken gehegt. Nein, es gab wirklich kein Gebot, das er nicht gebrochen hatte. Er sagte sie alle auf und betete, und dabei dachte er an seine Sünden. Er hielt inne. „Du sollst nicht falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten.“
Hatte er auch dieses Gebot gebrochen?
Nichts war im Alltag so gegenwärtig, kein Gebot wurde so oft gebrochen, keines verbreitete soviel Gift unter den Menschen. Jon dachte lange nach. Er dachte über sein Leben nach, dachte an seine Schulkameraden beim alten Gemeindepastor Rønnau, an seine Mitkonfirmanden, die Freunde bei Amtmann Trampe, seine Hausgenossen heute. Und er konnte sich nicht erinnern, auch nur ein einziges Mal das achte Gebot gebrochen zu haben. Er hatte niemanden verleumdet. Er hatte keinen unbewiesenen Klatsch weitergetragen. Im Gegenteil, oft hätte er die, die nicht anwesend waren, gern verteidigt. „Danke, lieber Gott, danke, daß du mich davor bewahrt hast, das achte Gebot zu brechen.“
Er hatte vor kurzer Zeit einen neuen Choral gelernt. Probst Wexels in Kristiania hatte die norwegische Fassung geschrieben. Die Melodie war von einer sich wiederholenden, eintönigen Tiefe, und deshalb war es leicht, sich eine Unzahl von anderen Melodien und Rhythmen auszudenken.
Jesu, Jesu komm zu mir,
o wie sehn ich mich nach Dir!
Meiner Seele bester Freund,
wann werd ich mit dir vereint?
Tausendmal begehr ich dein,
Leben ohne dich ist Pein.
Tausendmal ruf ich zu dir:
O Herr Jesu, komm zu mir.
Keine Lust in dieser Welt,
die mein Herz zufriedenstellt;
deine Liebe, Herr, allein
kann mein ganzes Herz erfreun.
Einmal würde er alles verstehen, er würde vor den Herrn treten, niederknien und ohne Schuld leben, ohne Versuchung. Und Gottes Liebe würde sein ganzes Herz erfreuen. Das verhieß das Lied – und seine Klänge enthielten eine Offenbarung.
Darum sehn ich mich nach dir,
eile, Jesu, komm zu mir;
nimm mein ganzes Herz für dich,
Читать дальше