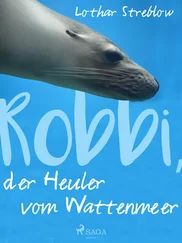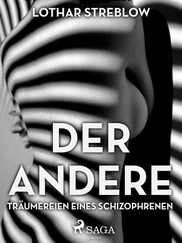Die vordere Schildkröte taumelte, fing sich aber wieder. Dann machte sie kehrt und griff ihren Verfolger an. Knirschend krachten die Panzer aufeinander. Ein scharfes Fauchen drang zwischen ihren Kiefern der anderen entgegen. Doch keine der beiden gab nach.
Immer wieder stießen sie wütend aufeinander zu. Mal taumelte die eine, mal die andere. Wenn der Rammstoß kräftig genug war, rutschte eines der beiden Panzertiere kurz ein Stück über den sandigen Boden. Und Staub wirbelte auf, trieb bis zu Duna hinüber.
Dann aber geschah es. Wieder einmal hatte die nur wenig Größere einen Rammstoß angebracht. Die Kleinere wurde durch die Wucht hochgehebelt, stand sekundenlang nur noch mit dem rechten Vorder– und Hinterbein auf dem Boden. In diesem Augenblick stieß die Größere nach, schob ihren Panzer unter den platten Bauch der anderen. Und die kippte um, kippte auf den Rücken, zappelte hilflos mit allen vier Beinen in der Luft.
Ungerührt wandte sich die Größere ab. Sie hatte erreicht, was sie wollte. Der Rivalenkampf der Schildkröten war zu Ende. Und mit erstaunlicher Geschwindigkeit rannte sie vom Kampfplatz weg zu einem Palmfarn, unter dem sich ein Schildkrötenpanzer träge bewegte. Hier weidete ahnungslos das hart umkämpfte Weibchen.
Duna stutzte. Doch es kam zu keinem neuen Kampf. Die dritte Schildkröte ergriff die Flucht, versuchte zu entkommen. Ihr Verfolger aber war schneller. Immer wieder versuchte er, der Flüchtenden in die Beine zu beißen. Und er biß mit seinen harten Kiefern zu, bis sie stehenblieb und Kopf und Vorderbeine unter den Panzer zog. Schwanz und Hinterbeine aber ragten noch hervor. Und mit einem Ächzen stemmte sich der Verfolger hoch und schob sich von hinten über ihren Panzer.
Duna sah zum erstenmal eine Schildkrötenpaarung. Die immer noch auf dem Rücken zappelnde Schildkröte aber schaffte es endlich, wieder auf die Beine zu kommen. Und ohne sich um die beiden anderen zu kümmern, kroch sie erschöpft ins nahe Dickicht.
Ein paar Tage lang weideten die Brontosaurier das Grün rund um den Tümpel ab. Und mitunter wälzten sie sich in das flache lauwarme Wasser, um Wasserpflanzen vom Grund zu rupfen. Es waren friedliche Tage.
Duna gefiel es hier. In dem Tümpel gab es keine Krokodile. Und auch an den Ufern trieben sich keine großen Raubechsen herum, nur ein paar kleinere; aber die hielten sich in respektvoller Entfernung und jagten die vogelähnlichen Saurier. Zwischen dem Pflanzengewirr bewegten sich auf zwei flinken Beinen kaum hühnergroße Reptilien, die nach Früchten und Insekten schnappten. Und abends quakten im Tümpel die Frösche.
Schläfrig blinzelte Duna in die fahle Dämmerung. Die Sonne war gerade blutrot hinter dem Horizont verschwunden. Und hier in Äquatornähe kam die Dunkelheit sehr rasch.
Allmählich wurde es ruhiger an den Ufern. Reptilien sind Tagtiere, nachts werden sie träge. Nur ein sechs Meter langer Stegosaurus streifte mit seinen mächtigen Knochenplatten raschelnd durchs Gezweig, als er sich einen Schlafplatz suchte. Ganz in Dunas Nähe verstummte das Rascheln.
Duna störte das nicht. Die Stegosaurier waren friedliche Pflanzenfresser. Manchmal suchten sie sogar gemeinsam mit den riesigen Brontosauriern nach Nahrung. Und auch Dunas Mutter kümmerte sich nicht um ihn.
Langsam sog die Dunkelheit die letzten Schatten auf. Doch völlig dunkel wurde es nicht. Am wolkenlosen Tropenhimmel flimmerten zahllose Sterne. Und als kurze Zeit später der Mond aufging und die urwüchsige Landschaft in bleiches Licht tauchte, begann es zwisehen dem Pflanzengewirr auf einmal lebendig zu werden.
Die ersten kleinwüchsigen Säugetiere kamen aus ihren Tagverstecken hervor, um nach schlafträgen Kleinreptilien zu jagen. Und sie fanden reiche Beute. Jetzt waren die Echsen den nachtflinken Warmblütern hilflos ausgeliefert.
Plötzlich spürte Duna ein paar scharfe Krallen an ihrem Schwanzende. Sie schreckte auf. Und abwehrend peitschte sie ihren Schwanz über den Boden, traf dabei auf etwas Warmes. Ein kaum katzengroßes Tier flitzte aufjaulend ins Dickicht. Offenbar hatte es Dunas dünnes Schwanzende für eine schlafende Eidechse gehalten. Und vermutlich war es genauso erschrocken wie Duna, die gerade noch das im Mondlicht bräunlich schimmernde dichte Fell erkannte.
Nun herrschte wieder Ruhe. Nur die Frösche quakten. Und ab und zu ertönte ein leises Rascheln, wenn einer der Säuger im Unterwuchs seine Beute verzehrte. Aber jetzt hielten sie sich fern von den Sauriern.
Erst gegen Morgen wurde Duna ziemlich unsanft geweckt. Es begann zu regnen. Die platschenden Tropfen auf ihrer nackten Haut weckten sie auf. Auch ihre Gefährten wurden allmählich munter.
Dunas Mutter reckte ihren langen schlanken Hals gegen den Himmel. Regenwasser rann von ihren mächtigen Flanken. Und mit noch schläfrigen Bewegungen stampfte sie gemächlich auf den Tümpel zu.
Duna spürte wenig Lust nach einem Bad. Sie war ohnehin naß. Und ihr Magen knurrte vernehmlich. Sie brauchte erst mal etwas zwischen die Kiefer.
Doch viel Genießbares gab es nicht mehr rund an den Ufern. Die riesigen Pflanzenfresser verzehrten unheimliche Mengen an Grünzeug. Und wo sie eine Weile geweidet hatten, wuchs kaum noch etwas.
Mißmutig platschte Duna in den modderigen Tümpel, um nach Wasserpflanzen zu suchen. Die mochte sie ohnehin am liebsten. Der Bodenbewuchs am sumpfig flachen Grund aber war zertrampelt, aufgewühlt von den tief eingesunkenen Füßen der tonnenschweren Großen. Duna bekam nur noch schlammiges Wasser auf die Zunge. Und das schmeckte ihr gar nicht. Mit hungrigem Magen stapfte sie zurück ans Ufer.
Inzwischen hatte auch Dunas Mutter gemerkt, daß hier nicht mehr viel zu holen war. Tropfend vor Nässe, stieg sie an Land. Und sie stapfte ohne Aufenthalt weiter. Mit ihrem mächtigen Körper walzte sie eine Gasse zwischen die kahlgefressenen Stämme. Und die anderen Brontosaurier schlossen sich ihr an, auf der Suche nach neuer Nahrung.
Über den Hügeln am Horizont hing fasriger Dunst. Dahinter stand eine verschwommene Sonne, ein fahles, unwirkliches Licht. Und es war heiß, drückend heiß.
Duna zockelte müde hinter ihrer Mutter her, zusammen mit den anderen Kleinen und flankiert von den beiden Großen. So liefen sie geschützt wie die Jungen einer Elefantenherde.
Wochen schon hatte es in dieser steppenartigen Gegend nicht geregnet. Der Boden war sandig und ausgetrocknet. Manchmal zogen sich graue Felsadern quer durch den Sand. Millionen winziger Glimmersplitter glitzerten in der Sonne. Und Staubfahnen wirbelten auf.
Hier fand Duna kaum einen saftigen Bissen. Ihre Mutter aber kannte ihr Ziel. In ihrem langen Leben war sie dieser Fährte schon oft gefolgt. Hinter den dunklen Hügeln wand sich ein träger Fluß durch die Landschaft, der auch nach langer Trockenheit noch Wasser führte. Dort hoffte sie auf frisches Grün.
Doch bis dahin war es noch weit. Kaum ein Windhauch regte sich. Und die Sonne stieg allmählich höher. Eidechsen jagten auf hitzeflirrendem Gestein nach Insekten. Zikaden lärmten in den weit auseinanderstehenden Wipfeln der wenigen Koniferen. Sonst war es still. Nur der körnige Sand knirschte unter den gewaltigen Füßen der Großen.
Plötzlich drang in die Stille ein seltsames Geräusch. Es hörte sich an wie ein leises Sirren. Und es nahm allmählich an Stärke zu. Doch zu sehen war nichts. Nur die Sonne schien hinter einem Schleier zu verschwinden, einem grau wogenden Schleier. Und ihr Licht begann zu verblassen wie bei einbrechender Dämmerung.
Noch aber war es Mittag. Dunas Mutter wand beunruhigt ihren langen Hals. Instinktiv spürte sie die nahende Gefahr. Nur kam sie nicht von einem Tier. Es schwang etwas in der Luft: etwas Unheimliches.
Mit einemmal fegte ein scharfer Windstoß durch die Wipfel der Koniferen. Die Zikaden verstummten. Und das sirrende Geräusch wuchs zum Brausen. Eine Wand schien auf Duna zuzurasen, eine riesige graugelb brodelnde Wand. Duna schwankte unter dem Druck des Sturmes. Und sie spürte die prasselnden Sandkörner schmerzhaft auf ihrer Haut.
Читать дальше