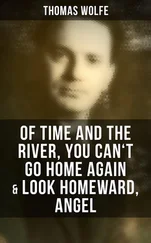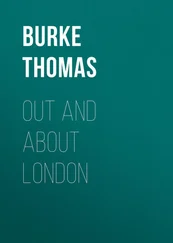Immer mehr Arbeitnehmer haben zudem keine festen Arbeitszeiten mehr, sondern bestimmen im Rahmen von Gleitzeitregelungen selbst über den Beginn und Ende ihrer täglichen Dienstzeit. Durch diesen Umstand darf es keine Ungleichbehandlung geben (z. B. bei der Freistellungs- und Lohnausfallregelung bei einsatzbedingtem Verlassen des Arbeitsplatzes). Gleichzeitig ist der Grad der Samstagsbeschäftigung gestiegen, durch die sowohl die Alarmverfügbarkeit von Einsatzkräften als auch die Möglichkeit zur Teilnahme an Wochenendlehrgängen eingeschränkt wird.
Vielen Berufstätigen ist trotz der gesetzlichen Regelung, dass sie während der Arbeits- und Dienstzeiten für die Teilnahme an Einätzen sowie Aus- und Fortbildungen freizustellen sind und hieraus keine beruflichen Nachteile erwachsen dürfen (vgl. beispielsweise § 20 BHKG), das Verlassen des Arbeitsplatzes für den Feuerwehrdienst nicht möglich.
Die Gründe hierfür sind mittlerweile vielfältig: Zum einen hat die fortschreitende Arbeitsverdichtung und Rationalisierung in den Betrieben zu einem erhöhten Arbeitsdruck geführt. Während vor einigen Jahrzehnten in vielen Betrieben noch ein gewisser Puffer in der Personalausstattung und den Arbeitsvorgängen vorhanden war, sind Betriebsprozesse und der Mitarbeitereinsatz heutzutage häufig so optimiert, dass sie keine Abweichungen oder Störungen vertragen. Der Waren- und Dienstleistungsmarkt beim Kunden lässt keine verspäteten Lieferzeiten, schlechte Qualität oder unzureichenden Service zu. Daher sind unplanbare Abwesenheiten durch in der Freiwilligen Feuerwehr tätige Mitarbeiter betriebsorganisatorisch nur schwer zu kompensieren.
Aber auch auf den Einzelnen lastet eine spürbar höhere Arbeitsbelastung mit dem Trend der steigenden beruflichen Inanspruchnahme. Selbst Landwirte und andere Selbstständige, die in der Vergangenheit klassischerweise der Garant für stets alarmverfügbares Einsatzpersonal waren, können sich das Verlassen des Arbeitsplatzes nicht mehr im gewohnten Umfang leisten.
Die Befürchtung beruflicher Nachteile durch den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr ist mitunter so groß, dass viele Feuerwehrangehörige sich nicht nur nicht trauen, im Einsatzfall ihren Arbeitsplatz zu verlassen, sondern sogar ihr ehrenamtliches Engagement in Bewerbungsgesprächen verschweigen, da sie befürchten, dass die unplanbaren Abwesenheiten vom Arbeitsplatz den potenziellen Arbeitgeber abschrecken. Die Befürchtung der beruflichen Nachteile führt soweit, dass viele Ehrenamtliche selbst für planbare Lehrgänge eher ihren regulären Jahresurlaub einsetzen, statt ihren Arbeitgeber mit dem gesetzlich zu diesem Zwecke zustehenden Sonderurlaub zu belasten.
Mangel an Qualifikationen
Aber nicht nur die sinkende absolute Anzahl an aktiven Mitgliedern in den Freiwilligen Feuerwehren stellt ein Problem dar. Auch ein Mangel an notwendigen Qualifikationen und der Bereitschaft zur Übernahme spezieller Funktionen ist zu befürchten. Dabei steht nicht nur die Fitness und Atemschutztauglichkeit eines jeden Einzelnen im Vordergrund. Die Zeit, die von jedem einzelnen Feuerwehrangehörigen in die Ausbildung sowie die regelmäßige Fortbildung investiert werden muss, ist mittlerweile ein so hohes Gut, dass die Bereitschaft, diese für den Qualifikationserwerb und -erhalt zu investieren, nur mit modernen, anforderungsgerechten und zielgruppenorientierten Schulungsmaßnahmen erzielt werden kann – welche wiederum (zumeist aus dem Ehrenamt heraus) vorbereitet und dargeboten werden müssen. Dazu kommt ein regelrechter Funktions- und Führungskräftemangel, da die Übernahme verantwortlicher Posten eine besondere Eignung der Person voraussetzt und häufig in einem größeren Zeitaufwand resultiert. Die Feuerwehrangehörigen, die in der Freiwilligen Feuerwehr Führungsaufgaben wahrnehmen, sind häufig auch im Hauptberuf Führungskraft. Bei dieser Doppelbelastung werden die Funktionäre sich im Zweifel für ihre beruflichen Verpflichtungen und gegen das ehrenamtliche Engagement entscheiden. Dabei wird an dieser Stelle deutlich, dass eine spürbare Reduzierung des Bürokratie- und Verwaltungsaufwands notwendig ist, damit mehr Zeit für die eigentliche Tätigkeit im Feuerwehrdienst zur Verfügung steht bzw. die zur Verfügung stehende Zeit effizient eingesetzt werden kann (vgl. »Ehrenamt braucht Hauptamt«, vgl. Kapitel 9.5.3.9).
Sicherung des hauptamtlichen Personalbestands
Auch die Gewinnung geeigneten hauptamtlichen Nachwuchses bei den Berufsfeuerwehren und hauptamtlich besetzten Wachen wird bei der aktuellen Arbeitsmarktsituation zunehmend schwieriger. Alle öffentlichen Bereiche sowie auch die privaten Unternehmen werben um qualifizierten und leistungsstarken Nachwuchs und unterbreiten mitunter die verlockenderen Angebote. Dabei konkurrieren die Feuerwehren als Arbeitgeber nicht nur mit anderen Branchen, sondern auch als Dienststellen untereinander: Es ist daher essentiell, sich als attraktiven Arbeitgeber darzustellen, um nicht nur neues Personal zu gewinnen, sondern auch die mühsam geworbenen, ausgebildeten und ständig weiterqualifizierten Kräfte zu erhalten und nicht an benachbarte Kommunen zu verlieren.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass hohe Anforderungen sowohl an die hauptberuflichen-, aber insbesondere auch an die freiwilligen Feuerwehrangehörigen gestellt werden, die nicht jeder Bürger bereit ist, ehrenamtlich für die Gesellschaft ohne direkte Entlohnung, zu verrichten:
 Ständige Alarmbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch an Wochenenden und Feiertagen,
Ständige Alarmbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch an Wochenenden und Feiertagen,
 Übernahme von Verantwortung, die sogar bis zum Entscheiden über Leben oder Tod reicht,
Übernahme von Verantwortung, die sogar bis zum Entscheiden über Leben oder Tod reicht,
 Eingehen von Risiken,
Eingehen von Risiken,
 Erhalt der körperlichen Fitness,
Erhalt der körperlichen Fitness,
 Absolvieren von Lehrgängen und Weiterbildungen,
Absolvieren von Lehrgängen und Weiterbildungen,
 ständige Fortbildung,
ständige Fortbildung,
 Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungen,
Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungen,
 hohes Engagement und Einsatzbereitschaft,
hohes Engagement und Einsatzbereitschaft,
 Einschränkungen im persönlichen Freizeitverhalten (z. B. Verzicht von Alkoholgenuss, Aufenthaltsort…).
Einschränkungen im persönlichen Freizeitverhalten (z. B. Verzicht von Alkoholgenuss, Aufenthaltsort…).
Dabei wird jedem Einzelnen das inzwischen wertvollste Gut unserer heutigen Gesellschaft abverlangt: die Investition von Zeit. Zeit, die damit nicht mehr für Familie, Freunde und Hobbies und andere Privataktivitäten zur Verfügung steht. All dieses kann und darf nicht als Selbstverständlichkeit angesehen werden und muss daher aktiv gefördert und wertgeschätzt werden. Personalfördernde Maßnahmen sind essentiell und unabdingbar für die personelle Sicherstellung der kommunalen Gefahrenabwehr, sodass sie auch im Bedarfsplan aufzuführen und politisch zu beschließen sind (vgl. Kapitel 9.5).
1 Zudem ist zunehmend eine steigende Anspruchs- und Erwartungshaltung der Bürger zu beobachten. Zwar konnte sich bislang die Feuerwehr in Zeiten, in denen sich Bürger mittlerweile über Ruhestörung durch Einsatzfahrzeuge mit Martinshorn beschweren und die Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber Rettungskräften zunimmt, trotzdem an der Spitze der alljährlichen Liste der angesehensten Berufe (Beamtenbund und Tarifunion (dbb), 2018) halten. Dennoch macht die Entwicklung zu einer »Hochleistungsgesellschaft« auch vor dem Rettungswesen keinen Halt, die mit hohem Anspruchsdenken und wachsendem Sicherheitsbedürfnis eine dienstleistungsorientierte Feuerwehr als universelle Hilfeeinrichtung fordert (»Vollkaskomentalität«). Heutzutage gibt sich der Hilfeersuchende nicht mehr nur damit zufrieden, dass die Feuerwehr »überhaupt geholfen hat«. Etwaige Schlechtleistungen der Feuerwehr 1 1 Faktische Schlechtleistungen oder aber auch nur von den Erwartungen des Hilfeersuchenden abweichende Leistung. 2 Neben den durchschnittlich insbesondere in großstädtischen Bereichen steigenden Einsatzzahlen kämpfen einige Feuerwehren gerade im ländlichen Bereich auch mit einem zu geringen Einsatzaufkommen. Was auf den ersten Blick kurios anmuten mag, kann sich zu einem ernsthaften Motivationsproblem von Feuerwehrangehörigen entwickeln, wenn die trainierten Fähigkeiten – dem Bürger zum Glück – nie eingesetzt werden können. werden nicht mehr toleriert, sondern beklagt und zumindest mit öffentlicher Imageschädigung sanktioniert (z. B. in der Lokalpresse oder den sozialen Netzwerken). Dieser Trend führt unweigerlich zum Zwang zur Professionalisierung und zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung der Feuerwehr, die zwar durchaus wünschenswert ist, der aber nicht nur im Ehren-, sondern auch im Hauptamt kaum nachgekommen werden kann. Nicht selten führt eine zu große Differenz zwischen dem Anspruch an die Feuerwehr und dem tatsächlich Leistbaren zu Frust und Demotivation bei den Einsatzkräften, denen häufig auch der nötige Dank sowie Wertschätzung ihrer Arbeit vorenthalten bleibt. Doch die Feuerwehr rückt sogar noch stärker in den Fokus: Veränderte soziale Strukturen haben mittlerweile zu sinkender Nachbarschaftshilfe und Selbsthilfefähigkeit der Bürger geführt. Die Vulnerabilität der Gesellschaft und eines jeden Einzelnen ist gestiegen. Beide Effekte führen dazu, dass immer häufiger staatliche Hilfe (zum Beispiel in Form der Feuerwehr) gesucht wird und die öffentliche Hand stärker belastet wird, als es früher bei selbstorganisierter Hilfe der Fall gewesen ist.
Faktische Schlechtleistungen oder aber auch nur von den Erwartungen des Hilfeersuchenden abweichende Leistung.
Читать дальше
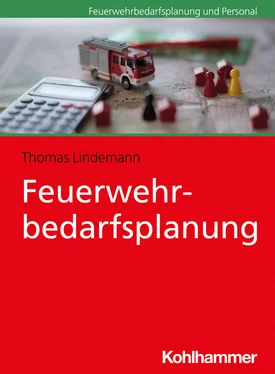
 Ständige Alarmbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch an Wochenenden und Feiertagen,
Ständige Alarmbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch an Wochenenden und Feiertagen,