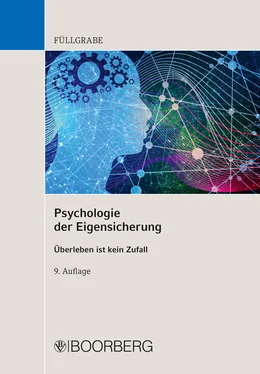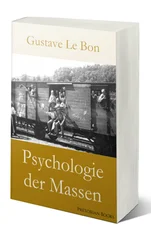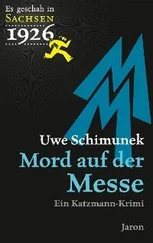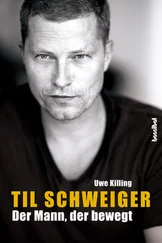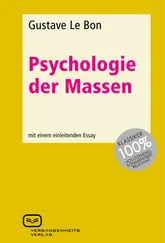Gerade in Gefahrensituationen ist aber nicht Angst, sondern eine gelassene Wachsamkeit notwendig, also eine genaue Beobachtung der Situation, ohne Gedanken an die eigene Person. Dies ist die Voraussetzung eines guten Gefahrenradars:
Der Polizist muss z. B. abweichende Verhaltensmuster eines Autofahrers registrieren und Gefahrensignale rechtzeitig wahrnehmen (z. B. Griff des Verdächtigen unter den Fahrersitz).
Man glaubt, für gefährliche Situationen gerüstet zu sein, ohne dass das tatsächlich der Fall ist. Dies wird z. B. am falschen Gebrauch des Wortes Routine deutlich, das sich auf regelmäßig vorkommende Handlungsabläufe bezieht.
Verkehrsüberwachung ist eine Aufgabe vieler Polizisten, die sie mit großer Häufigkeit ausüben. Deshalb werden derartige Kontakte mit dem Bürger als Routine angesehen. Relativ vielen Polizisten kommt aber überhaupt nicht in den Sinn, dass eine Verkehrskontrolle auch gewaltbereite Personen betreffen könnte.
Routine kann also in zweifacher Hinsicht gesehen werden: a) Nachlassen der Wachsamkeit, nachdem viele Interaktionen friedlich, unauffällig blieben oder b) es ist überhaupt, von Anfang an, keinerlei Wachsamkeit vorhanden (Gedankenlosigkeit).
Das Problem ist aber keineswegs, dass man durch harmlose Interaktionen in seiner Wachsamkeit „eingelullt“ worden ist. Das Problem ist vielmehr, dass man seit Beginn seiner beruflichen Laufbahn keine oder nur ungenügende kognitive Schemata für Gefahrensituationen aufgebaut hat, keinen „Gefahrenradar“ entwickelt hat. Lange Zeit spielte dieses Defizit im beruflichen Alltag für den einzelnen Polizisten keine Rolle, weil die Interaktionen harmlos waren. Das Defizit wird dann aber in Gefahrensituationen deutlich: Der Polizist weiß nicht, wie er sich verhalten soll, zögert, lässt sich vielleicht sogar die Dienstwaffe aus der Hand nehmen und damit erschießen, wie z. B. in einem Fall aus den USA (Pinizzotto & Davis, 1995).
Wie stark der Stress tatsächlich ist, wenn man nicht mental auf eine sachgemäße Gefahrenbewältigung eingestellt ist, zeigen folgende Verhaltensweisen deutscher Polizisten:
Eine Streifenbesatzung fuhr zu einer ‚häuslichen Auseinandersetzung‘. Bei ihrem Eintreffen kam ihnen ein Mann entgegengerannt, bedrohte sie verbal und hielt eine Geflügelschere hoch erhoben. Beide Beamten hatten die Waffe gezogen und im Anschlag, wobei der Sichernde durch seinen Kollegen kein freies Schussfeld hatte. Der vordere Beamte hatte es allerdings, und die Situation spielte sich auch im Hausflur, also bei gesichertem Umfeld, ab. Die Bedrohung war wohl recht offensichtlich – der Schusswaffengebrauch war prinzipiell angemessen und sicher möglich. Nicht für den Beamten vor Ort: Dieser entschloss sich, lieber mit seiner Waffe nach dem Täter zu werfen (!!!) und anschließend ‚manuell‘ einzugreifen. Bei dieser ‚Aktion‘ wurden Täter und Beamter nicht unerheblich, wenn auch nicht schwer, verletzt. Im Nachhinein äußerte der Beamte sich sinngemäß wie folgt: „Klar wusste ich, dass ich dabei verletzt werde. Aber wenn ich geschossen hätte, hätte ich eh keine Wirkung erzielt und dann hätt’ er mich abgestochen. So war’s wenigstens wirksam“ (Lorei, 2001).
Adams (2005) stellte Personen aus Ghana und San Francisco (USA) verschiedene Fragen zu den Themen Freundschaft und Feindschaft und stellte dabei erhebliche Unterschiede in der Deutung dieser Phänomene fest. Auf die Frage, ob man persönlich Feinde habe, antworteten z. B. 48 % der Westafrikaner (WE) und 26 % der Amerikaner (US) mit „Ja“. Auf die Frage, ob die Annahme von Feinden in seiner Nähe abnormal bzw. paranoid sei, entschieden 9 % WE und 45 % US mit „Ja“. Entsprechend beurteilten 50 % WE und 19 % US den Glauben, keine Feinde zu haben, als naiv.
Auf die Frage, wie sie reagieren würden, wenn sie persönlich einen Feind hätten, antworteten 30 % der Nordamerikaner mit „ignorieren“, während dies nur 54 % der Westafrikaner vorzögen. Sie würden im Gegensatz eher aktiv den Feind meiden oder sich Schutz vor diesem suchen (26 % WE vs. 11 % US).
Das Ignorieren von potenziellen Feinden kann sehr gefährlich sein. Derartige Gedankengänge gehen an der Tatsache vorbei, dass jeder grundsätzlich Opfer eines Verbrechens werden könnte, wenn er nicht vorsichtig ist.
Dazu ein beliebiger Zeitungsbericht (Hessisch/Niedersächsische Allgemeine HNA vom 11. 12. 2003) über einen Sänger der Popgruppe Die Prinzen , der von zwei Männern nachts überfallen, „aus Spaß“ verprügelt und dann verletzt und reglos am Boden liegend zurückgelassen wurde. Sie sollen gesagt haben: „Es ist doch alles nur Spaß. Wir wollen nur ein paar Euro, wir wollen nur ein paar Bier trinken.“ und bei der Vernehmung, dass sie „einfach nur Frust ablassen“ wollten.
Es wird häufig betont, dass Deutschland eines der sichersten Länder der Welt sei. Das mag zwar statistisch im Vergleich zu anderen Ländern richtig sein. Doch dem Opfer einer Straftat ist es herzlich egal, ob anderswo die Kriminalität höher oder geringer ist oder ob sie im eigenen Land sinkt. Diese statistische Betrachtung wirkt einlullend, suggeriert den Eindruck, dass man nichts tun müsse, und verstellt den Blick dafür, dass es jeden unerwartet treffen kann.
Dazu ein aktueller Fall aus der HNA vom 28. 12. 2016. Ende Oktober 2016 geht eine 26-jährige Frau nichtsahnend die Treppe zum Berliner U-Bahnhof Herrmannstraße hinab. Plötzlich tritt ihr ein Mann ohne Vorwarnung so heftig in den Rücken, dass sie die Treppe hinabstürzt und sich den Arm bricht. … Besonders die demonstrative Teilnahmslosigkeit des weiterschlendernden Tatverdächtigen und dreier Begleiter löste bundesweit Empörung aus.
Wie Adams (2005) feststellte, nehmen viele Amerikaner nicht an, persönlich das Ziel von Feinden zu sein. Diese Annahme hat sich auch nach den Anschlägen vom 11. September 2001 nicht grundlegend geändert; nur Minderheiten der Befragten nehmen an, dass Feindschaften aufgrund von Nationalitäten entstehen. Afrikaner sehen eher im Phänomen Feindschaft ein alltägliches Problem, vor dem sich jeder mit Aufmerksamkeit und Vorsicht schützen sollte. Diese Annahme erscheint dagegen vielen Amerikanern eher als paranoid. Entsprechend sehen sie sich erstaunlicherweise auch für eventuelle persönliche Feindschaften als mitverantwortlich an. So stellten sich die Studenten von Virginia Tech nach dem Amoklauf (2007) die Frage: „Was haben wir falsch gemacht?“, obwohl sie mehrfach vergeblich versucht hatten, den Täter in eine Interaktion einzubinden (Füllgrabe, 2016).
Derartige falsche Vorstellungen sind relativ weitverbreitet und gefährlich. So sieht Douglas (1996, S. 396) aus der Sicht des FBI-Praktikers den Sachverhalt, dass relativ viele „therapierte“ Mörder wieder rückfällig wurden, neben unangemessenen Methoden auch darin begründet, dass „oft junge Psychiater, Psychologen und Sozialarbeiter tätig sind, die idealistische Vorstellungen haben und denen man an der Universität beigebracht hat, dass sie wirklich etwas verändern können. … Oft verstehen sie nicht, dass sie Individuen vor sich sehen, die ihrerseits Experten in der Beurteilung anderer Leute sind! Nach kurzer Zeit wird der Insasse wissen, ob der Arzt seine Hausaufgaben gemacht hat, und wenn nicht, kann er sein Verbrechen und das, was er den Opfern angetan hat, in anderem Licht darstellen.“
Aber nicht nur als Gutachter kann man von manchen Tätern „über den Tisch gezogen werden“, sondern kann auch direkt angegriffen werden, wobei die Täter keine Dankbarkeit gegenüber demjenigen zeigen, der ihnen geholfen hat.
Dies musste auch die Psychologin Susanne Preusker erfahren, die bis 2009 Leiterin einer sozialtherapeutischen Abteilung für Sexualstraftäter in einem Hochsicherheitsgefängnis war und therapeutisch mit Gewalttätern arbeitete. Dabei wurde sie von einem ihrer Patienten als Geisel genommen und brutal vergewaltigt (Preusker, 2011a). Sie schrieb (2011b):
Читать дальше