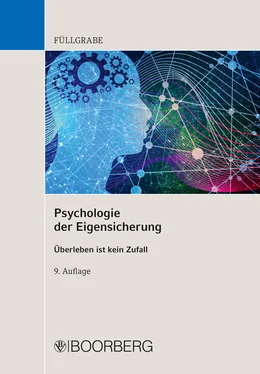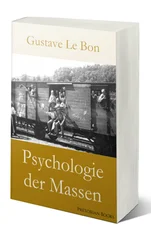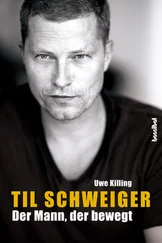Was dann geschah, ging so schnell, dass Jonathans Vater es nur mit viel Glück bemerkte. Der Vater sprach mit einem der anderen Erwachsenen, als er zufällig beobachtete, dass ein Mann, die Augen starr auf Jonathan gerichtet, aus der Menge geradewegs auf sie zukam. Sein Blick war so auffällig fixiert, dass es dem Vater seltsam vorkam, und er den sich nähernden Mann fest im Auge behielt, allerdings zunächst eher verwundert denn alarmiert. In dem Moment, als der Mann Jonathan erreichte, legte er dem Jungen die Hand auf die Schulter. Plötzlich packte er Jonathan am Arm und versuchte, mit ihm im Getümmel zu entschwinden.
Jonathans Vater machte einen Satz nach vorn, als er sah, wie sich die Hand des Mannes seinem Sohn näherte, und schaffte es gerade, als dieser in die Menge abtauchte, seinem Sohn den Arm um die Taille zu legen. Der Mann ließ von dem Jungen ab und verschwand.“
Der Vater hatte also einen guten Gefahrenradar. Starre fixierte Augen sind nämlich zumeist ein Hinweis auf einen Angriff.
Man muss also betonen: Jeder hat zunächst selbst die Verantwortung für sein eigenes Leben. Und zur Bewältigung gefährlicher Lagen ist Survivability wichtig. Darunter ist die Gesamtheit aller psychologischen Faktoren der Gefahrenwahrnehmung und Gefahrenvermeidung zu verstehen.
Zunächst ist dazu eine innere Haltung notwendig, die Hamlet (Shakespeare, o. J., S. 119) so formulierte: „Geschieht es jetzt, so geschieht es nicht in Zukunft; geschieht es nicht in Zukunft, so geschieht es jetzt; geschieht es jetzt nicht, so geschieht es doch einmal in Zukunft. In Bereitschaft sein ist alles.“ („If it be now, ’tis not to come; if it not come, it will be now; if it be not now, yet it will come. The readiness is all.“), Deshalb gilt das Prinzip: Erwarte das Unerwartete! Sei vorbereitet! Ripley (2010, S. 15) schrieb entsprechend: „.. bin ich heute, nachdem ich dieses Buch über Katastrophen geschrieben habe, weniger ängstlich. Ich kann Risiken sehr viel besser einschätzen.“ Und deshalb sind Verhaltenstipps überlebenswichtig.
Es gibt natürlich auch Situationen, in denen man weniger Überlebenschancen hat als in anderen. Gemäß Miller (2011, S. 122) haben aber Personen sogar Bärenangriffe überlebt, indem sie sich tot stellten. Er betont: Das ist keine hochprozentig erfolgreiche Strategie, aber wenn die Umstände wirklich schlecht sind, ist eine gering prozentige Strategie besser als nichts. Und, wie in diesem Buch gezeigt wird, kann eine selbstsichere Körpersprache Angreifer abschrecken, selbst wenn man den potenziellen Angreifer nicht bemerkt.
Man hat die Wahl, Gefahrensituationen wahrzunehmen und seine mehr oder minder großen Möglichkeiten (und die sind zumeist sehr groß!!) auszuschöpfen, oder man bleibt unvorbereitet und entwickelt, wenn doch ein Unglück passiert, posttraumatische Symptome.
4. Wie kann man Survivability erwerben?
Manche Menschen haben bereits auf der Grundlage ihrer Persönlichkeit eine hohe Survivability. So berichtet mir eine Ärztin, wie sie einen Handtaschenraub vermeidet:
• Sie meidet Menschenmengen. Taschendiebe haben nämlich ein großes Geschick, zu Personen Körperkontakt aufzunehmen, um sie auszurauben. Sie umarmen z. B. die Person und begrüßen sie als alten Freund.
• Sie hat die Handtasche fest am Körper, sodass man sie ihr nicht entreißen kann.
• Sie hat einen selbstsicheren Gang. Grayson und Stein (1981) stellten durch die Befragung von Gewalttätern genau fest, welche subtilen Merkmale des Ganges einer Frau sie als leichtes Opfer oder als Nichtopfer – das man besser nicht angreift – kennzeichneten (s. a. Füllgrabe, 1997, S. 172; 2016).
• Sie ist wachsam, aber nicht ängstlich = gelassene Wachsamkeit.
• Sie ist neugierig, ist also offen für neue Informationen, was nach Siebert (1996) typisch für Überlebenspersönlichkeiten ist.
Sie bezeichnet sich also treffend als „Nichtopfer“. Das bewies sie direkt bei einem Ereignis mit potenziell gefährlichem Ausgang:
„Bei einem Waldlauf in der Dämmerung traf ich auf einen Mann, der mit einem alten Damenfahrrad neben dem breiten Waldweg stand. Er erwiderte meinen Gruß nicht und schaute weg. Beim Weiterlaufen merkte ich, dass er das Fahrrad auf den Weg stellte und hinter mir herfuhr. Beunruhigt überlegte ich, wie ich aus dieser Situation entkommen konnte, während ich, um nicht ängstlich zu erscheinen, den Weg weiter bergauf lief. Der nahegelegene Autobahnparkplatz schied aus, weil ich nicht sicher war, dort auf Menschen zu treffen. Also bog ich nach einer Kurve auf einen kleineren Waldweg ein, von dem aus ich, falls mich der Mann verfolgt hätte, querfeldein gelaufen wäre, um als geübte Läuferin zu entkommen. Kurz nach der Kurve traf ich auf einen Bekannten mit großem Hund.“
Die Ärztin besitzt also das, was Siebert (1996, S. 185) als Überlebensstil bezeichnet: „Der Überlebensstil ist, die Realität schnell zu erfassen und gleichzeitig nach der besten Aktion oder Reaktion aus dem eigenen Reservoir paradoxer Ressourcen zu schöpfen.“ Wo andere das demonstrative Wegsehen nicht beachtet oder als Schüchternheit oder als Unhöflichkeit gedeutet hätten, deutete sie es richtig: als ein mögliches Gefahrensignal („No-look Rule“, s. Kapitel 5, S. 80). Die Ärztin besitzt also einen guten Gefahrenradar. Tatsächlich stellte sie, als sie dann weiterlief, fest, dass der Mann sie verfolgte. Wichtig ist auch der Hinweis, dass sie nicht ängstlich erscheinen wollte. Denn: Wer Angst oder Unsicherheit zeigt, wird eher angegriffen (s. z. B. Grayson & Stein, 1981, Füllgrabe, 1997, 2016). Sie geriet aber nicht in panische Angst, sondern überlegte detailliert, wohin sie laufen sollte. Dabei entwickelte sie alternative Fluchtmöglichkeiten, eine hohe kognitive (geistige) Leistung angesichts einer potenziellen Gefahr.
Man sieht hier gut, dass ein guter Gefahrenradar, planvolles Überlegen statt Angst und Hilflosigkeit typische Merkmale einer Überlebenspersönlichkeit (Siebert, 1996) sind.
Wie entwickelt sich aber ein solcher Überlebensstil? Obwohl es darüber wenige verlässliche Informationen gibt, liefert das Beispiel der Ärztin doch erste Hinweise darauf. Sie wurde zur Selbstständigkeit erzogen und dass sie auf sich aufpasst. „Ich musste immer für mich selber sorgen.“ Und es wurde ihr das Gefühl vermittelt, alles selber schaffen zu können (= Gefühl der Selbstwirksamkeit).
Nishiyama und Brown (1960) meinen, dass durch das Karatetraining (und natürlich auch durch andere Kampfsportarten/Kampftechniken) die von ihnen genannten psychologischen Faktoren gefördert werden können. Tatsächlich haben Kampf sport arten und -systeme verschiedene positive psychologische Auswirkungen. Eine Untersuchung von Bodin und Martinsen (2004) mit klinisch Depressiven zeigte z. B., dass schon ein kurzzeitiges Üben von Kampfsport (im Gegensatz zum Fahren eines stationären Fahrrades) bei Ungeübten eine Reihe positiver Wirkungen haben kann: eine positivere Stimmung, eine Verringerung negativer Gefühle und von Angst und vor allem eine erhöhte Selbstwirksamkeitserwartung, d. h. die eigene Erwartung, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen erfolgreich selbst ausführen zu können.
Eine Angehörige der IHSDO, einer Verteidigungssportart, berichtete mir, dass sie eine größere Wahrnehmungsgenauigkeit, ein höheres Selbstbewusstsein, bessere Reflexe und eine verbesserte Fitness entwickelt habe. Die Verbesserung der Fitness ist auch deshalb wichtig, um sich schneller aus einer Gefahrensituation entfernen zu können.
Untersuchungen mit einem Eyetracker, der der Analyse der Blickbewegungen dient, zeigten deutliche Unterschiede zwischen Kampfsportexperten und Personen ohne Training. Diese achten nicht auf Details, streifen vorhandene Personen nur kurz mit einem Blick und sind womöglich noch durch Telefonieren abgelenkt.
Читать дальше