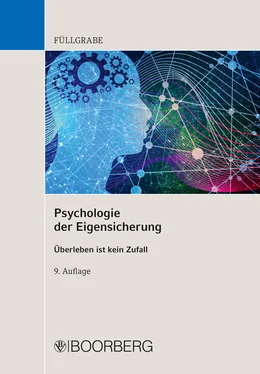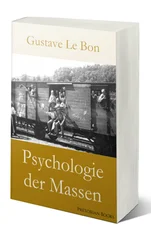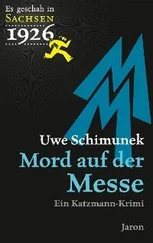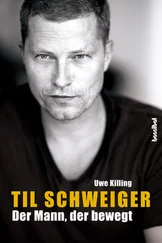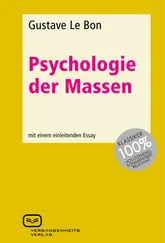1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 ( http://www.wingtsun-kassel.de/erfolgsgeschichten_zivilcourage.html).
Durch entschlossenes Auftreten, möglichst vor dem Hintergrund – vorher in Realitätsübungen – eingeübter Techniken ( sachgerechte polizeiliche Maßnahmen, Selbstverteidigung usw.), kann man Gefahrensituationen gut bewältigen.
Wie man Kinder gut auf die Bewältigung von Gefahren vorbereiten kann, wird im Kap. 9.17 geschildert.
Kapitel 2 Grundlagen der Gefahrenbewältigung
1. Unterschiedliche Gefahrensituationen
Um Gefahren sachgemäß bewältigen zu können, ist es zunächst einmal wichtig, den abstrakten Begriff „Gefahr“ zu konkretisieren, denn Gefahrensituationen können sich erheblich voneinander unterscheiden und damit auch die Fähigkeiten zu ihrer Bewältigung. Man könnte mögliche Gefahren z. B. klassifizieren gemäß
Bedrohung, z. B. durch
• zwischenmenschliche Situationen, z. B. eine feindselige Person,
• Krankheiten,
• Naturgewalten, Erdbeben, Feuer u. Ä.
2. dem Grade der Beeinfl ussbarkeit bzw. Entwicklung der Gefahr:
| ↑ |
↑ |
↑ |
| sucht die Gefahrensituation selbst auf (z. B. Bergsteiger) |
eine gefährliche Situation baut sich auf (z. B. Polizist und Gewalttäter) |
schwer vorhersagbar(z.B. Erdbeben) |
Der Bergsteiger oder ein Stuntman kann z. B. durch eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung aller möglichen gefährlichen Situationen und Durchführung entsprechender Maßnahmen seine Gefährdung sehr gering halten, ein Polizist durch sachgemäße Eigensicherung.
| ↑ |
↑ |
| plötzlichauftretende Krise(z. B. Überfall) |
längerfristige Krise(z. B. Leben in einem Gefangenenlager) |
Für das Bewältigen einer Krise sind gut gelernte oder sogar automatisierte Reaktionen notwendig; in längerfristigen Krisen hat man dagegen mehr Möglichkeiten zu planen. Man ersieht aus diesen Klassifikationsmöglichkeiten, dass zur Bewältigung unterschiedlicher Arten von Gefahren höchst unterschiedliche Fähigkeiten notwendig sein können. So trifft ein Polizist vorwiegend auf Gefahren im zwischenmenschlichen Bereich, während für einen Feuerwehrmann die Bedrohung bei einem Brand durch materielle Dinge verursacht wird wie die Flammen, aber auch durch Rauchentwicklung und die dadurch bewirkte Dunkelheit.
Für die Gefahrenbewältigung ist das Prinzip wichtig: Vorbereitet sein!Viele Gefahren sind nämlich voraussehbar, und man kann sich auf sie einstellen.
Richter und Berger (2001) stellten fest, dass in 62,5 % der Angriffe von Patienten gegen Mitarbeiter einer psychiatrischen Klinik ein Konflikt mit anderen Personen vorausgegangen war, in 47,7 % der Fälle mit dem Personal. In vielen Fällen gingen den Ereignissen Anzeichen einer Eskalation voraus: Drohende Gestik der Patienten, geringe Körperdistanz Patient – Personal, Beschimpfungen, offensichtliche Verwirrtheit.
An manche Gefahrenquellen denkt man aber überhaupt nicht, obwohl sie im Beruf auftauchen können.
Eine Befragung von 290 amerikanischen und kanadischen Polizisten ergab, dass 269 (93 %) während des polizeilichen Dienstes hingefallen waren, davon 76 % mehrfach. 89 % fielen während einer Verhaftung hin, wobei 94 % dieser Gruppe vom Boden aus kämpfen mussten (DuCharme, 2001).
Jemand, der jetzt darauf hinweisen würde, dass dies doch eine amerikanische Untersuchung sei und einen selbst beruflich nicht betreffe, weil man selbst noch nie im Dienst hingefallen sei, wäre eine Person mit geringerer Survivability. Denn es geht überhaupt nicht darum, ob diese Prozentzahlen auch für deutsche Polizisten gelten, sondern darum, dass man folgende Fragen beantworten kann: Was mache ich, wenn ich einmal hinfallen sollte? Bin ich auf diese Lage überhaupt vorbereitet?
2. Allgemeine und spezifische Faktoren der Survivability
Die verschiedenen Klassifikationsmöglichkeiten von Gefahren zeigen auf, dass es spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten gibt, die zur Bewältigung dieser Gefahrenart notwendig sind, aber nicht für andere. Aber neben rein spezifischen Überlebensfaktoren gibt es auch solche, die grundsätzlich für das Überleben höchst unterschiedlicher Gefahren eine Rolle spielen. Siebert (1996) stellte beispielsweise fest, dass eine synergistische Persönlichkeit Gefahren besser bewältigen kann (s. a. Kap. 10), d. h. eine Persönlichkeitsstruktur, bei der weniger das ICH als vielmehr das Gesamtsystem im Mittelpunkt des Denkens steht. Diese ICH-Freiheit des Denkens bewirkt eine gelassene Wachsamkeit für das Unterscheiden zwischen harmlosen Dingen und Gefahren und ein ruhiges, sachorientiertes Handeln, gerade in Gefahrensituationen. Wie man diesen angstfreien Zustand erreichen kann, zeigte Jappy (2001) am Beispiel der Bombenentschärfer. Folgende Faktoren halfen ihnen, die Gefahr zu bewältigen: Sorgfalt, Präzision und ein Selbstvertrauen, das nicht aus Überheblichkeit, sondern aus der Einstellung stammt, Teil einer Gemeinschaft zu sein.
In einer Fernsehsendung („Feuer!“; Hessischer Rundfunk 26. 7. 1998) beschrieb ein amerikanischer Feuerwehrmann, wie er in einem Hotel durch eine gute Vorbereitung und besonnenes Handeln im Falle eines Brandes seine Überlebenschancen erhöhen kann. Er nimmt nur ein Hotelzimmer, das höchstens im 7. Stock und zur Straße liegt, weil die meisten Feuerwehrleitern nur bis zum 7. Stock reichen. Sobald er im Hotel angekommen ist, schaut er, ob es Sprinkleranlagen und Rauchmelder gibt, wo Feuerlöscher sind. Er erkundet den Fluchtweg, geht dazu im Hotel den Weg ab und zählt die Türen bis zum Ausgang (damit er sich auch bei Dunkelheit und Rauch schnell retten kann). Die Motivation für seine Vorsichtsmaßnahmen begründet er folgendermaßen: „Ich mache es für meine Sicherheit. Ich mache es noch mehr für meine Familie.“ Gerade dieser letzte Satz ist typisch für Personen mit synergistischer Persönlichkeit.
Das Beispiel dieses Feuerwehrmannes zeigt auch auf, dass der entscheidende Denkansatz der Überlebensfähigkeit lautet: Vorbereitet sein!Und dieser Denkansatz ist bei Personen mit hoher Survivability mit bestimmten psychologischen Faktoren verknüpft und wird in problemorientiertes Handeln umgesetzt.
Interessanterweise war es gerade Miyamoto Musashi (1584–1645), der bedeutendste japanische Schwertmeister, der in seinem Werk Das Buch der fünf Ringe die Bedeutung von Kooperation schilderte. Er sah das Endziel der Beschäftigung mit Kampfkünsten im Aufbau und sachgemäßem Regieren eines gerechten und gut funktionierenden Staates. Abgesehen vom Spezifischen über den Schwertkampf in seiner Schrift kann man bei Musashi viele Einsichten über das Überleben gefährlicher Situationen und die dazu notwendigen Persönlichkeitsstrukturen und Problemlösungsstrategien finden. Das Buch Psychologie der Eigensicherung stellt deshalb gewissermaßen eine wissenschaftliche Weiterführung der systemisch orientierten Gedanken Musashis hinsichtlich des Erkennens und Bewältigens gefährlicher Situationen dar.
3. Die Vernetzung psychologischer und körperlicher Faktoren
Dieses Buch ist kein Ersatz für ein Training von realistischen Situationen für die Eigensicherung; die Survivability ist aber die psychologische Grundlage und sogar Voraussetzung für die Umsetzung dieser Techniken. Durch eine passive Haltung, Angst usw. kann nämlich die Umsetzung dieser Techniken in der Praxis verhindert werden.
Читать дальше