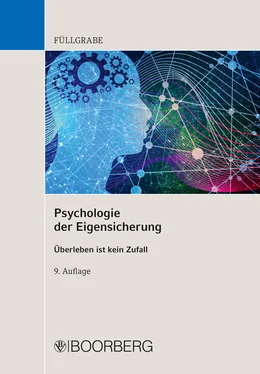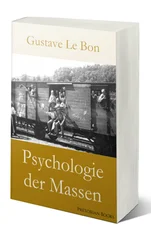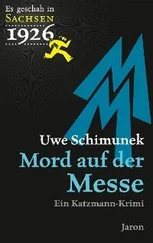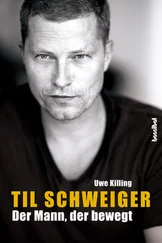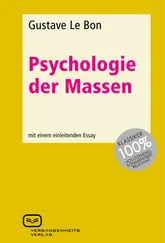All dies kann man nicht ermitteln, wenn man z. B. nur Statistiken über Angriffe auf Polizisten analysiert. Denn diese sagen nichts aus über das Denken und Handeln von Menschen und vor allem nichts darüber, was sich in der Interaktion zweier Menschen konkret abspielte, wie man den Konflikt hätte vermeiden können usw. Statistiken haben also nur einen sehr begrenzten Wert für das Verständnis von Gewalt und Eigensicherung. Und vor allem geben sie keine praktischen Handlungshinweise.
Aber auch die bloße Darstellung einzelner Fälle ist aus theoretischen und praktischen Gründen nicht ausreichend. Denn es ist wichtig, übergeordnete Muster zu finden und einen inneren Zusammenhang der Faktoren herzustellen. Dazu habe ich aus den empirisch gewonnenen Informationen und wissenschaftlichen Erkenntnissen ein Modell entwickelt, das ich Survivability (von to survive und ability ) nannte und sich auf die psychologische Seite des Überlebens bezieht. Dieses Modell ist umfassend, weil es sich mit allen Phasen einer Gefahrensituation beschäftigt: vor, während und nach dem Ereignis und dafür jeweils konkrete Handlungshinweise gibt.
Survivability umfasst drei Bereiche:
1. Psychologische Prozesse/Persönlichkeitsunterschiede:
Manche Menschen bewältigen Gefahrensituationen besser als andere, weil sie sich von diesen unterscheiden hinsichtlich:
a) Persönlichkeitsunterschiede:Individuelle Unterschiede hinsichtlich Wahrnehmung der Situation, Reaktionsbereitschaft, Stressbewältigung usw.
b) Kenntnissevon Gefahren in bestimmten Situationen, von der Psychologie gewaltbereiter Personen und deren Tricks und Angriffstechniken (ob sie also „streetwise“, „streetsmart“ sind) usw.
c) Techniken zur Problembewältigung: Selbstverteidigungstechniken, Erste Hilfe, sachgemäße Vorgehensweisen bei polizeilichen Lagen, z. B. Verkehrskontrollen, Amoklagen usw.
2. Die richtige Strategie: TIT FOR TAT
Man muss freundlich sein, aber sich sofort gegen Betrug, Gewalt usw. wehren.
3. Handelngemäß dem Mentalen Judo
Das mentale Judo besteht aus vier Stufen, je nach dem Stadium der Gefahr:
a) Vordem Umkippen des nichtaggressiven Zustandes einer Situation in Gewalt:
Eigensicherung:
– Nichtsprachliche und sprachliche Signale der Selbstsicherheit
– Wer selbstsicher auftritt, wird seltener angegriffen.
– „Gefahrenradar“
– Gelassene Wachsamkeit bedeutet, dass man sich angstfrei bewegen kann, aber genau die Situation beobachten sollte, registrieren, was sich in der Situation abspielt und auf Veränderungen der Situation oder des Verhaltens einer Person achten.
– Reaktionsbereitschaft
– Mit Entschlossenheit handeln
b) Im Verlauf einer Krise
Bewältigung der Phasen einer Krise durch:
– vorherige Stressimpfung (vorherige geistige Vorbereitung auf Gefahrensituationen)
– Abrufen automatisierter Verhaltensweisen
c) Bei schweren Verletzungen und Bedrohungen des Lebens
– Aktivierung des psychologischen Immunsystems
Selbst wenn man schwer verletzt wird oder sich in Todesgefahr befindet, hat man immer noch Überlebenschancen, wenn man das psychologische Immunsystem aktiviert. Es besteht konkret aus Gedanken an wichtige Bezugspersonen, Ärger über den Täter u. Ä., um Gefühle und Gedanken der Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit zu verhindern und um zu lebensrettendem Handeln zu motivieren.
– Schrittweises Handeln zum Entkommen aus der Gefahrensituation
d) Nachbereitung des Ereignisses
Überlegungen: Was kann ich aus dem Ereignis lernen? Was kann ich besser machen?
Es gibt keinen absoluten Schutz gegen Gefahren (selbst Siegfried in der Nibelungensage hatte keinen), doch hat man es selbst in der Hand, seine Überlebenschancen beträchtlich zu erhöhen, durch Aktivwerden, statt passiv zu bleiben. Oder, wie es Thompson (1997) in seinem Buchtitel formulierte: „Dead or alive: The choice is yours“ („Tot oder lebendig: Du hast die Wahl“).
Survivability hilft aber nicht nur, gefährliche Situationen zu bestehen, sondern ist auch ein wirksamer Schutz gegen das Auftreten posttraumatischer Symptome. Da posttraumatische Symptome dadurch entstehen, dass man plötzlich unvorbereitet von einer Katastrophe überrascht und dadurch das Gefühl der Unverletzbarkeit zerstört wurde (Janis, 1971), ist man durch die mentale und technische Vorbereitung auf solche Situationen auch vor solchen Symptomen geschützt. Deshalb gilt das Prinzip: Expect the unexpected! Be prepared! (Erwarte das Unerwartete! Sei vorbereitet!).
In Kampfsportkreisen ist man sich einig, dass in Gefahrensituationen die Psychologie eine wichtige Rolle spielt (z. B. Nishiyama & Brown, 1960). Doch was bedeutet Psychologie in diesem Zusammenhang genauer? Wer einen Blick in Psychologiebücher wirft, wird enttäuscht werden. Man findet nichts (oder kaum etwas) über die Entstehung gefährlicher Situationen, wie man Gefahren erkennen kann, wie man sich in gefährlichen Situationen verhalten soll, um nicht zum Opfer zu werden usw.
Selbst in einem sehr informativen Buch über Bereiche der Rechtspsychologie (Volbert & Steller, 2008) findet man lediglich ein Kapitel zu Gewaltsituationen, das sich aber nur mit dem Thema Opfererfahrung (Greve, 2008) beschäftigt. Dies ist nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht unangemessen, weil hier nur der häufig vermeidbare Endzustand einer gewalttätigen Interaktion abgehandelt wird, aber nicht, was sich bereits vorher abspielte. Dahinter steckt auch ein pessimistisches Weltbild: Wenn man Pech hat, wird man zum Opfer. Es werden also keine Strategien und Verhaltensweisen in Betracht gezogen, dass man eben nicht zum Opfer wird. Dies ist umso erstaunlicher angesichts der Tatsache, dass man sogar Chancen hat, einem Serienmörder zu entkommen, durch Aktivwerden, wie Ressler et al. (1986, S. 307; s. a. Füllgrabe, 1997, S. 310; 2016, S. 336) zeigten: vor dem Angreifer verstecken, aus dem Auto springen, Tod vortäuschen, aus der Gegend fliehen (wie z. B. Rhonda Stapley, die dem Serienmörder Ted Bundy entkam), dem Angreifer die Waffe aus der Hand schlagen, um Hilfe schreien. Eine Frau wartete die günstige Gelegenheit ab, bis der Täter die Pistole nicht mehr auf sie richtete (er wollte ihre Hände zusammenbinden). Die Pistole war eine Todesdrohung, doch gefesselt zu werden, erhöhte die Verletzbarkeit der Frau. So riskierte sie den Kampf trotz Pistole. Die Praxis zeigt nämlich, dass jemand, der sich fesseln lässt, leichter Opfer einer Gewalttat wird. Ein pessimistisches Weltbild hingegen verhindert also nicht nur die technische Vorbereitung auf gefährliche Situationen (z. B. durch Sicherheitsmaßnahmen, Selbstverteidigungstechniken), sondern auch die Ausbildung problemlösender innerer Monologe (Gedanken) in/für gefährliche Situationen. In solchen Situationen sind statt lähmender Gedanken motivierende und problemlösende Gedanken notwendig.
Dieses Buch soll also sowohl aus theoretischen als auch praktischen Gründen zum Thema Gewalt erkennen und Gewaltbewältigung eine Lücke schließen.
2. Warum Kampfsportarten (alleine) nicht immer wirkungsvoll sind
Der Begriff Survivability wird meist bezogen auf konkrete Techniken zum Überleben in der Wildnis oder in der kriegerischen Auseinandersetzung. Aber seltsamerweise wurde nie oder kaum die psychologische Seite des Überlebens betrachtet.
Wie wichtig aber die psychologische Komponente in gefährlichen Situationen ist, zeigen verschiedene Beispiele. So erweisen sich Kampf sport arten (gleichgültig ob mit japanischem, koreanischem, chinesischem o. ä. Hintergrund) in Gefahrensituationen nicht immer als wirkungsvoll. Kain (1996, S. 147) erwähnt z. B. einen 3. Dan Karate, der eines Tages zu einem von Kain veranstalteten Kurs erschien, mit einem Gesicht, das zerschlagen und voller Blutergüsse war. Er berichtete, dass er letzte Nacht überfallen wurde. Eine Amerikanerin (2. Dan Karate) und Gewinnerin mehrerer Kata- und Kumitemeisterschaften wurde abends überfallen und vergewaltigt ( http://modelmugging.org/choosing-a-course-for-women/martial-science/evolution-of-martial-science/).
Читать дальше