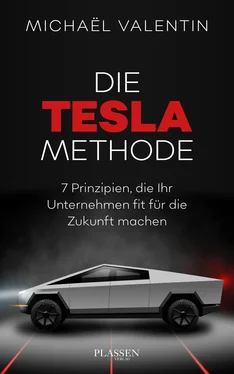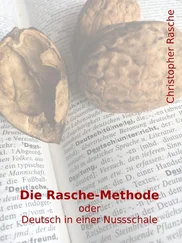Dieses Buch ist ein Gemeinschaftsprojekt, das nur durch die bereitwillige Zusammenarbeit einer großen Zahl von Personen, Kollegen, Unternehmenschefs, Beschäftigten und Partnern von Tesla möglich wurde. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei all jenen, die mir geholfen haben, das Projekt in Angriff zu nehmen und zum Abschluss zu bringen, von der Idee über die Analyse von Betriebsstudien bis hin zur Bearbeitung des Manuskripts.
Mein Dank gilt Charles Bouygues für seine Hilfe und Energie bei der Vereinbarung von Gesprächen im Silicon Valley. Besonderer Dank gebührt Renan Devillières, weil er mir unvergleichliche Einblicke in alle Aspekte der Software-Hybridisierung eröffnete, David Machenaud für seine generelle Unterstützung und Raphaël Haddad für seine Hilfe beim Aufbau des Buches.
Herzlichen Dank auch allen Personen und Unternehmen, die bereit waren, sich darin zu äußern und mir so viel über die fachlichen und menschlichen Gesichtspunkte des Themas nahegebracht haben.
Ich danke auch all jenen aus meinem Umfeld, die indirekt zu diesem Buch beigetragen haben, allen voran Frédéric Sandei, Philippe Grandjacques und Grégory Richa.
Ebenso bedanke ich mich bei Odile Ricour und Adélaïde Lechat für ihre Zuarbeit und bei Bidane Beitia, Laurène Laffargue, Soizic Audouin, Abir Bruneau, Denis Masse, Antoine Toupin, Robin Cellard, David Fernandez, Clément Niessen, Quentin Lallement, Hadi Mahihenni, Anass Khamlichi, Romain Pigé, Jean Baptiste Sieber und Sébastien Desbois für ihre konkrete Hilfestellung bei der Kontaktaufnahme mit Tesla und anderen „Leuchttürmen“ der Industrie der Zukunft.
Vielen Dank auch an Julie El Mokrani Tomassone, Esther Willer und Chloé Sebagh für ihre Unterstützung und Begeisterung beim Lektorat, für alle Verbesserungen und dafür, dass die Kommunikation nie abgerissen ist.
Abschließend möchte ich mich von ganzem Herzen bei Marie-Laure Cahier bedanken, ohne deren Zutun das Buch in dieser Form nicht vorliegen würde, bei Alan Sitkin und Susan Geraghty für ihre Hilfe bei der englischsprachigen Fassung, bei Ro’isin Singh für ihre sorgfältige Überarbeitung früherer Entwürfe und bei meiner Verlegerin Julia Swales für das in mich gesetzte Vertrauen.
Es waren meine jüngsten Beobachtungen zum Zustand der Industrie in den am höchsten entwickelten Ländern, zu ihren Organisationssystemen und dem technischen Fortschritt der vergangenen zehn Jahre sowie zu den aktuellen sozioökonomischen Veränderungen, die mich dazu animiert haben, dieses Buch zu schreiben. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung und einer im Niedergang begriffenen Industrie halte ich das Geschäftsmodell und das Betriebs- und Managementsystem des Teslismus für eine mögliche Lösung. Wie und warum ich aber dazu kam, Die Tesla-Methode zu schreiben, erklärt sich meiner Ansicht nach am besten aus meinem persönlichen Kontext.
Nachdem ich 1995 die Schule mit guten Noten abgeschlossen hatte, war ich nicht sicher, was ich studieren sollte. Wäre es nach meiner Familie gegangen, hätte ich unbedingt Arzt oder Notar werden oder in die Politik gehen sollen. Es wäre alles infrage gekommen, nur nicht das produzierende Gewerbe. In einer französischen Kleinstadt schlossen sich gesellschaftlicher Erfolg und Fabrikarbeit schlichtweg aus. Mein Weg in den Industriesektor begann daher erst, als ich auf den Fluren des Gymnasiums, das ich gerade verlassen hatte, eine Freundin traf (ihr Name war Véronique). Mit solchen Noten könne ich unmöglich Medizin studieren, fand sie. Eine Ingenieurwissenschaft schien ihr eher geeignet. Und sie hatte recht. Schließlich hatte ich gleich in mehreren naturwissenschaftlichen Fächern bei den Prüfungen gut abgeschnitten, doch aufgrund meiner kultureller Voreingenommenheit nicht wirklich begriffen, welche akademischen Möglichkeiten sich dadurch boten. Nach ein paar mit Mitabiturienten durchfeierten Nächten begann ich mich nach einem Praktikumsplatz umzusehen. Bauingenieurwesen hatte es mir auf Anhieb angetan: Das schien mir doch eine ganz solide Sache zu sein – kein Wunder, schließlich war dabei ja auch Beton im Spiel.
Als ich es bis zum Vorarbeiter gebracht hatte, rief mich ein Freund an, der an der renommierten technischen Hochschule Ponts et Chaussées studierte. Sein Spezialgebiet war die Produktion, und er träumte davon, irgendwann eine Fabrik zu leiten. Ich ging ebenfalls dorthin, und einen Monat später stand ich in einer Michelin-Fabrik im irischen Ballymena. Dort infizierte ich mich mit dem Industriefieber. Jeden Tag rollen dort über 1.000 Reifen aus den mehr als drei Meter hohen Öfen. Für einen jungen Studenten wie mich war das ein eindrucksvoller Anblick. Nach den Reifen wollte ich wissen, wie Autos produziert werden. Ich war absolut fasziniert davon, wie so ein Metallblech aus dem Walzwerk kommt und sich in wenigen Stunden in eines der komplexesten Systeme verwandelt, die der Mensch je erfunden hat – ein Produkt, von dem weltweit an jedem Tag der Woche über 140.000 Stück erzeugt werden.
Diese Begeisterung führte mich weiter auf meinem Weg in die Industrie. Im Verlauf meiner Ausbildung wurde ich befördert und leitete ein Team von Wartungstechnikern. Da erkannte ich allmählich die Stärke dieses einträglichen Sektors. Viele betrachten die Industrie stereotyp als starr und öde, übersehen dabei aber, wie oft es eigentlich um den Faktor Mensch geht. Mein Team und ich, wir entwickelten uns rasch zu einer versierten schnellen Eingreiftruppe und taten alles, was in unserer Macht stand, um zu verhindern, dass die Fertigungsstraßen stillstanden. Unsere Lösungen setzten stets beim Teamwork an und bei den Herausforderungen, die damit einhergingen: Man musste aufmerksam zuhören, aber dennoch auch unbequeme Entscheidungen treffen können. Manchmal stützten sich diese auf einen Konsens, doch ganz einfach war das nie. Warum? Weil die Fertigung eine komplexe Angelegenheit ist, die viel Mut erfordert. Tentakelartige Logistikketten sind komplex. Produkte, die aus Zigtausenden von Komponenten bestehen – und in ebenso vielen Variationen vorkommen –, sind komplex. Der Betrieb von Organisationen im Zeitalter der glücklichen Globalisierung ist komplex. Und sogar einfache Herstellungsprozesse sind komplex. Doch wiederum gilt: Das Herzstück der Produktion oder Rohstoffverarbeitung sind die Menschen – auch wenn immer ein paar darunter sind, die krampfhaft versuchen, ihr Gesicht zu wahren, indem sie so tun, als hätten sie alles unter Kontrolle.
Natürlich gibt es neben all dieser Komplexität auch noch die schlichte Schönheit eines Umfelds, in dem die Arbeiter an den Maschinen Tag für Tag Hand in Hand mit Technikern, Ingenieuren und Forschern arbeiten. Das ist ein unglaubliches Abenteuer. Jeder Beteiligte hat seinen eigenen sozialen Hintergrund, doch sie alle wirken zusammen, um das System zu optimieren. Das ist sicherlich eine Herausforderung – aber hey, wirklich unglaublich spannend. Ein wahrhaft einzigartiges menschliches Abenteuer.
Als ich in die Beraterbranche wechselte, blieb mir diese Begeisterung unvermindert erhalten und verdrängte bald die Skepsis, mit der ich die Beraterwelt betrachtete. Als Unternehmensberater hatte ich die Möglichkeit, Hunderte von Fabriken zu besuchen, mit verschiedenen Teams zusammenzutreffen und mich in unzählige komplexe und aufregende Fragen zu vertiefen, und zwar in einer Vielzahl von Sektoren: Schwerindustrie, Mechanik, Chemie, Pharmaindustrie, Bioproduktion, Werkzeugmaschinen, Konsumgüter und sogar handwerkliche Unternehmen, die sich im Luxussektor halten konnten, obwohl der Markt von all den neuen Technologien überschwemmt wurde. Ich lernte, dass es so etwas wie „die Industrie“ gar nicht gab, sondern dass sie in Wirklichkeit viele Gesichter hatte.
Damit sind wir schon im Jahr 2008. Damals litt der Fertigungssektor unter schlechter Presse. 30 Jahre lang hatten die Fabriken in Frankreich eine „Fabless“-Strategie verfolgt, und viele betrachteten die Fertigung als eine Aktivität, deren Zeit abgelaufen war. Im Trend lag die Vorstellung, dass Dienstleistungen in den nächsten Jahren die Hauptrolle spielen würden. Die Eliten erkannten dies und richteten ihre Politik auf die Sektoren aus, die ihrer Ansicht nach zukunftsträchtig waren. Frankreich hatte damals einen mächtigen Trumpf im Ärmel. In den 1980er-Jahren lieferten sich die französische und die deutsche Automobilindustrie ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bis die deutschen Hersteller eine Hegemonialstellung errangen und Japan oder auch China weltweit ebenfalls ein stärkeres Gewicht erlangten. 2008 waren die Würfel schon gefallen, und alles war anders. Meine früheren Klassenkameraden waren Finanzanalysten, Trader oder Internetspezialisten geworden. Das produzierende Gewerbe nahm kaum einer richtig ernst. Im Fernsehen wurde laufend über Fabrikschließungen berichtet. Im Wahlkampf sprachen die Politiker von „Rettungsplänen“ für die Produktion. Alle waren sich einig: Der Industriesektor war ernsthaft krank und vermutlich nicht zu retten.
Читать дальше