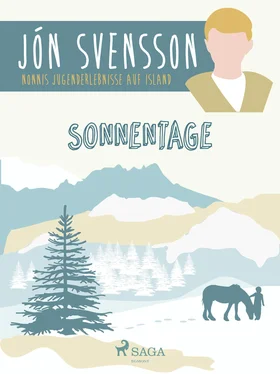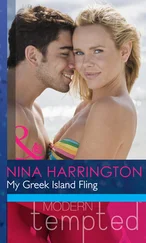Die Schneemassen schlugen, vom Winde geworfen, mit solcher Wucht auf die Dächer, dass man es im ganzen Hause poltern und krachen hörte.
Ich lief unter die Haustür und starrte hinaus.
Welch ein Anblick!
Man sah weder Erde noch Himmel noch Luft.
Millionen von Schneeflocken wirbelten wie rasend durcheinander. Sie fielen fort und fort hernieder, stets gejagt von neuen Millionen: ein zahlloses Heer beschwingter Eiskristalle, die gekommen schienen, um die Erde zu überfallen und alles unter ihren mächtigen Massen zu begraben, Menschen und Tiere, Häuser und Höhen, Felsen und Klüfte. Nichts konnte ihnen widerstehen.
Wer jetzt draussen war im Freien, der war ihnen wehrund rettungslos ausgeliefert. Man musste sich lebendig begraben lassen und warten, bis der wilde Angriff aufhörte.
Selbst in den Häusern wurde es unheimlich.
Die Haustüren mussten geschlossen werden, damit es den Schnee nicht hereinwerfe und die Gänge verschneie.
Drinnen in der Stube versammelten sich die Leute. Niemand sprach ein Wort; alle waren wie gebannt von der unendlichen Macht der entfesselten Naturkräfte.
In wenigen Augenblicken ward es stockfinster, denn alle Fenster waren im Nu mit einer dicken Lage Schnee bedeckt. Man musste die Lichter anzünden.
Auf allen Gesichtern ruhte tiefer Ernst.
Auch ich sann still und stumm vor mich hin. Meine Gedanken aber weilten draussen auf dem Berge.
Wie wird es den vier Hirten gehen? dachte ich. Und mein lieber, guter Júlli! Er lag jetzt irgendwo tief unter dem Schnee. O, wenn er nur am Leben bliebe!
Mir wurde so weh in der Brust, dass ich hätte weinen mögen.
Und dann all die vielen Schafe, besonders die arme, kleine Dúfa, auch sie litten dasselbe Schicksal.
Während wir in der warmen Stube sassen, mussten sie draussen in dem schrecklichen Unwetter frieren, begraben unter dem kalten Schnee! ...
Der Orkan tobte noch mit ungeschwächter Kraft.
Ich wurde dadurch etwas von meinen trüben Gedanken abgelenkt.
Der rasende Sturm wurde in meiner Vorstellung zu einem unbändigen lebenden Wesen, das wie ein Berserker wutschnaubend über unsere Gegend hinfuhr.
Aber ach, solch dichterische Einfälle konnten meinen Sinn nicht lange fesseln. Immer wieder musste ich daran denken: unsere guten, braven Leute und die vielen hilflosen Schafe und Lämmer, sie waren verschneit und begraben! ...
So sassen wir in der grossen Stube da beim Lampenschein, wie wenn es stockfinstere Nacht gewesen wäre. Wann es Abend wurde, konnte man bloss an der Uhr merken.
Bevor wir Kinder zu Bett gingen, wollten wir nach dem Abendgebet Gott noch besonders bitten, er möchte doch Júlli und Dúfa und all den andern helfen.
Da wir schon die Erwachsenen hatten beten sehen, machten wir es ebenso wie sie: wir sassen da, die Hände vor dem Gesicht, und beteten, so andächtig wir es konnten, still und jedes für sich.
Allzu lang freilich dauerte es nicht. Die kleine Sigga war zuerst fertig und meinte kindlich aufrichtig, es könnte jetzt vielleicht genug sein.
So gingen wir denn zu Bette, ganz traurig und mit verweinten Augen.
Lange noch waren wir wach. Schliesslich aber wurden wir müd und schliefen ein. —
Mitten in der Nacht wurde ich geweckt: eine kleine Hand legte sich sachte auf meinen Kopf.
Ich schlug die Augen auf, sah aber nichts, denn es war ganz dunkel in unserem kleinen Schlafzimmer.
Ich griff nach der Hand. Es war Waldi, der aufgestanden und an mein Bett gekommen war.
„Nonni“, flüsterte er, „ich kann nicht schlafen. — Glaubst du, Júlli und Dúfa müssen sterben?“
„Ich weiss nicht!“ erwiderte ich leise.
Das war alles, was ich sagen konnte.
Wir wurden beide wieder so traurig, dass wir anfingen bitterlich zu weinen.
Der Orkan draussen toste noch immer; doch schien es, als wäre er endlich weiter fort.
Die andern Kinder schliefen, das hörten wir an ihren ruhigen Atemzügen.
Nach einer Weile sagte Waldi wieder:
„Warum ging aber Júlli auch hinaus? Das hätte er nicht tun sollen.“
„Nein“, antwortete ich, „das hätte er nicht tun sollen; aber er ist eben so mutig.“
„Ja“, fügte Waldi hinzu, „und er hat immer gesagt, er wolle lieber ein kurzes Leben mit Ehre als ein langes mit Schande.“ ...
Und dann ging der kleine Knabe weinend zurück in sein Bett.
Bald darauf schlummerten wir wieder ein und schliefen länger als gewöhnlich. Wir waren ja auch so müde gewesen von der grossen Angst und Sorge und Betrübnis. —
Als uns am Morgen das Mädchen den Kaffee ans Bett brachte, war unsere erste Frage:
„Wie ist das Wetter?“
„Die Stórhríð ist vorbei“, sagte sie; „sie sind jetzt gerade daran, sich vorn bei der Tür hinauszugraben.“
Wir kleideten uns rasch an und liefen durch die dunkeln Gänge zur Haustüre.
Dort brannten ein paar Lampen, und am Boden lagen viele Schneeklumpen.
Die waren von den Schuhen abgefallen. Die Männer, die einen Gang durch den Schnee gruben, brachten sie mit herein.
Nach langer, mühsamer Arbeit kamen sie endlich bis zur Oberfläche des Schnees empor, und nun drang wieder Tageslicht zu uns herab.
Damit man leichter hinaussteigen konnte, wurden in die Schneewand eine Art Stufen gegraben.
Das Wetter war wieder klar, aber frostig kalt.
Inzwischen wurden alle Vorbereitungen getroffen, die Hirten und Schafe zu bergen.
Man nahm lange Holzstangen und befestigte an dem einen Ende starken Eisendraht. Der hatte Windungen ähnlich wie die eines gewöhnlichen Korkziehers.
Andere holten Schaufeln und Spaten auf dem ganzen Hofe zusammen und pfiffen alle Hunde herbei, die noch zu Hause waren.
Dann verliess der so eigenartig ausgerüstete Zug, junge und ältere Männer, den Hof.
Nur Weiber und Kinder blieben daheim.
Die Rettungsarbeit geht auf folgende Weise vor sich:
Zunächst werden die Stellen aufgesucht, wo man vermuten kann, dass die Verunglückten unter dem Schnee begraben liegen.
Da müssen dann die Hunde an der Oberfläche wittern und spüren.
Fängt einer an zu scharren und zu graben, so ist das ein Zeichen, dass das Tier mit seinem feinen Geruchsinn entdeckt hat, da unten muss etwas Lebendes sein.
Nun eilen sogleich die Männer herbei, und einer steckt die lange Stange hinab, bis er auf Widerstand stösst.
Sobald er dies merkt, dreht er die Stange einige Male herum, wie man einen Korkzieher in den Pfropfen bohrt.
Lässt sich jetzt die Stange ohne Schwierigkeit wieder heraufziehen, so kann man annehmen, dass kein lebendes Wesen unten ist; steckt sie dagegen fest, dann muss sich die Drahtspirale in der Wolle eines Schafes oder in den Kleidern eines Menschen verwickelt haben.
In diesem Falle gehen die Männer sofort mit aller Kraft daran, den Eingeschneiten auszugraben. —
Aber, wird vielleicht der Leser denken, wie ist es denn möglich, dass einer so weit unter dem Schnee längere Zeit leben kann? Da muss man doch notwendig ersticken!
O nein, so gefährlich ist das nicht. Die Luft dringt überraschend leicht auch durch dicke Schneeschichten. Auf Island kommt es zum Beispiel gar nicht selten vor, dass Schafe mehrere Wochen lang tief unter dem Schnee begraben liegen und schliesslich doch lebend in ihrem unheimlichen kalten Grabe gefunden werden. —
Einige Zeit, nachdem die Männer mit den Hunden hinausgezogen waren, kletterten wir Kinder bei der Haustür die hohe, feste Schneewand hinauf.
Oben war es grimmig kalt; aber es bot sich uns ein seltsamer Anblick dar.
Die Landschaft war gar nicht wieder zu erkennen. Es gab fast keine Unebenheiten mehr im Erdboden, keine Felsen, keine Klüfte, keine Hügel, keine Häuser und keine Stallgebäude.
Selbst unser ganzes Gehöft schien beinahe verschwunden. Da, wo es stand, sah man nur eine einzige grosse Erhebung in dem Schneeteppich.
Читать дальше