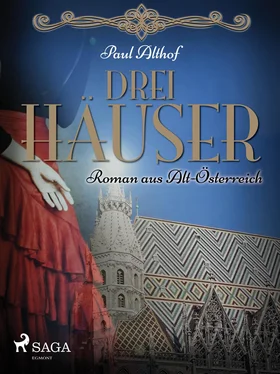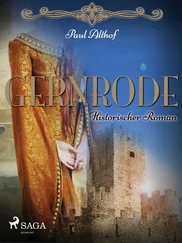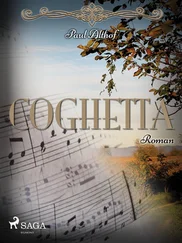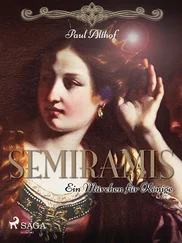„Für diesen Jungen muß etwas geschehen!“ rief Teresa, lebhaft applaudierend. „Wir sollten ihn zu einem Meister nach Wien schicken!“ „Ja, an das Wiener Konservatorium. Ich beantrage eine Kollekte“, pflichtete Lambrecht bei und warf zwei Dukaten auf eine Silberschüssel, die er den Gästen der Reihe nach präsentierte.
„Ich habe meine Geldbörse nicht bei mir“, entschuldigte sich Stasia.
„Hier ist mein Obolus. Honny soit, qui mal y pense“, krähte Kwiecinski, der ein Viertelguldenstück in die Schüssel fallen ließ.
„Meine Mutter unternimmt solche Dinge gern ohne die Mitwirkung anderer“, flüsterte Béla, hinter Lambrecht tretend. Der Oberleutnant wurde rot. Um nichts in der Welt wollte er sich die Gunst seiner zukünftigen Schwiegermutter verscherzen. „Übrigens“, lächelte Béla, „übrigens haben Sie mir einen guten Gedanken eingegeben ... Ich schenke dir die Geige Bernhard.“
„Die Geige? ...“ stammelte der Knabe.
„Ja. Du kannst sie behalten.“
Jetzt nahm der allgemeine Tanz seinen Anfang. Die Sporen der Offiziere klirrten. Das Licht der Wachskerzen schimmerte auf den spitzenbesetzten Seidenroben, auf den Brillanten in den Chignons der Damen. Schwere Schleppen, mit einem Gewirr von Falbeln und Rüschen, glitten halb hoch genommen über das spiegelglatte Parkett. Stasia’s Dekolleté, das erheblich gewagter war, als der übliche Courausschnitt, bedeutete für die jungen Leutnants ein Erlebnis.
Als sich die Paare zur Quardrille aufstellten, erschien Sepp, der Kellermeister, an der Saaltüre und wechselte einige Worte mit Baronin Amadé.
Sie trat rasch an die Musikestrade heran und sagte: „Bernhard, dein Vater schickt um dich, du sollst nach Hause kommen.“
Die Augen des Knaben wurden groß und starr. Die Geige unterm Arm, folgte er stumm dem Kellermeister auf den schmiedeeisernen Gang, der den neuen Saalanbau mit dem alten Familienhause verband. Dort stand Bernhardts kleiner Bruder Jozsi und wartete.
„Was will der Vater von mir?“ fragte Bernhard. „Die Mutter ruft dich. Du sollst dich beeilen!“
Eine beklemmende Angst hinderte Bernhard, weitere Fragen zu stellen. Die beiden Knaben begannen zu laufen, rannten atemlos durch die nächtlichen Gassen. Drückende Schwüle lag über der Kleinstadt. In der Richtung des Dorfes Gelse zuckten Blitze. Das Vieh in den Ställen brüllte aufgestört. Hähne krähten aus dem Schlaf. Immer schneller lief Bernhard, und Jozsi konnte kaum mit ihm Schritt halten. Da wehte ihnen betäubender Akazienduft entgegen. Sie waren am Ziel. Unter den blühenden Bäumen am Haustor, stand der Vater und winkte: „Nicht du, Jozsi, nur Bernhard soll zu ihr hineingehen.“
War das die Mutter, seine schöne Mutter? Man hatte ihr eine weiße Haube umgebunden, aus der ihr Gesicht bleich und traurig hervorsah. O, er wollte sie gleich fröhlich machen!
„Schau, Mutter, die Violin’ hat mir der Baron geschenkt“, flüsterte er und legte seine Geige auf die Bettdecke. Frau Eva’s Hand berührte unversehends die Saiten. Der Klang weckte die fast schon bewußtlose Frau, und auf ihren Lippen erschien ein glückliches Lächeln: „Spiel’ Bernhard, mein Bub, spiel“, sagte sie.
Bernhard gehorchte. Wie süß die Geige sang! Allen Jubel und alles Leid konnte sie singen. Alle Lieblingslieder der Mutter spielte er, fröhliche und traurige, bis ihm der Vater den Bogen aus der Hand nahm. Denn Eva Bálint war entschlafen.
Schwer und langsam begriff der Knabe, daß die Mutter tot war. Die Geige lag fortan unberührt im Schrank; traurig hockten die Kinder in der dumpfen Stube.
Es war etwas Fremdes, Unfaßbares in das Leben Bernhards gekommen. Der Vater, zu dem er bisher wie zu einem mächtigen Beschützer aufgesehen hatte, schien haltlos, schwach und fast weibisch in seinen Schmerzausbrüchen. Um keinen Preis hätte Bernhard vor fremden Leuten Tränen vergossen. Er fühlte, daß er seine Kindheit verloren hatte und nunmehr auf sich allein gestellt war.
Mitleidige Nachbarinnen hantierten an diesen Tagen im Hause. Sie brachten mehr Unruhe als Ordnung in die Räume. Da erschien eines Morgens Baronin Amadé in Begleitung ihrer Tochter und ihres Vetters Don Carlo Casalanza und verlangte den Cymbalspieler Bálint allein zu sprechen. Furchtsam beäugten die Kinder den hohen Geistlichen, doch als Bernhard ihnen bedeutete, daß dieser ein gnädiger, herablassender Herr sei, rieben Pali und Klein-Regina ihre Näschen an seiner Hand, während Jozsi bloß einen Zipfel der Soutane erwischte, um einen Kuß darauf anzubringen. Dann standen die Kinder geduckt und mäuschenstill vor der geschlossenen Türe, hinter welcher die vornehmen Besucher ein langes Gespräch mit dem Vater führten. Als er herauskam, schien er freudig bewegt. Die Baronin trat an die Wiege seines jüngsten Kindes, hob es aus den Kissen und legte es ihrer Tochter Antonietta in den Arm.
„Seien Sie unbesorgt, lieber Bálint“, sagte Teresa, „für Ihre kleine Fiorenza werden ich und mein Bruder, Baron Casalanza, der gestern aus Trient angekommen ist, treulich sorgen. Morgen ordnen wir das Materielle beim Notar. Und du, Bernhard, entscheide selbst und überlege, ob du den Fleiß und die Ausdauer in dir fühlst, um am Wiener Konservatorium das Geigenspiel von Grund auf zu erlernen. Die Mittel zum Studium und zu einer bescheidenen Lebenshaltung gebe ich dir. Du könntest schon morgen reisen, wenn du dich dem ehrwürdigen Don Carlo Casalanza anschließen würdest, der unseren Neffen Falco nach Wien begleitet.“
Bernhard wollte sprechen, aber konnte er die überschwänglichen Dankesbezeugungen seines Vaters überbieten? Als die Besucher sich entfernt hatten, blieb er versonnen neben der leeren Wiege stehen.
„Vater, weshalb tun sie das alles? Warum nehmen sie Rozsinka fort? Warum?
„Weil sie wohltätige Menschen sind, mein Sohn.“
„Nein Vater! Sie tun es, weil der kleine Baron die Schuld hat am Tod unserer Mutter.“
„Schweig, Bernhard! Wir sind arme Zigeuner ...“
„Und Rozsinka? Nicht einmal den Namen darf sie tragen, den ihr die Mutter geben wollte. Man hat sie Fiorenza Antonia getauft. Und nirgends wird sie zu Hause sein. Bei den Herrschaften nicht und bei uns auch nicht.“
„Red’ nicht so! Eine vornehme Dame soll unsere Fiorenza einmal werden. Vielleicht eine reiche Baronesse! Was weiß ich?“
„Keine Mutter wird sie haben. Kein Vaterhaus. Keine Heimat.“
Vater Bálint wendete sich ab und kramte umständlich in altem Gerümpel, bis er ein Felleisen fand, das Bernhards Habseligkeiten für die Reise aufnehmen sollte. Aber das Wenige, das er besaß, war schnell untergebracht und füllte das Felleisen kaum zur Hälfte. Dann wurde die Geige aus dem Kasten genommen, in ein seidenes Schultertüchlein gewickelt, das die Mutter Sonntags getragen hatte und wieder sorgfältig, fast ehrfürchtig in den Geigenkasten gelegt.
Als es Abend wurde, mußte Vater Bálint zur „Krone“ gehen, wo die Zigeuner spielten.
„Kannst mitkommen“, sagte Bálint zu seinem Sohne. „Ich zahle dir ein Nachtmahl.“
„Danke schön. Hab keinen Hunger.“
„Der Zug geht erst um Mitternacht. Was willst du bis dahin anfangen?“
„Wenn ich zur Bahn gehe, komm ich noch Abschied nehmen.“
Der große Speisesaal im Hotel „Krone“ war übervoll und der Rauch darin so dicht, daß Bernhard bei seinem Eintritt die Zigeunerkapelle in ihrem Winkel, wie durch einen Schleier sah. Stimmengewirr und Tellergeklapper mischten sich mit den Geigen- und Cymbaltönen. Ein paar weinselige Gäste sangen mit. Die meisten aber nahmen keine Notiz von den Musikanten. Schüchtern versuchte Bernhard bis zu seinem Vater vorzudringen. Kaum hatte dieser seinen Sohn erblickt, so rief er dem Zigeunerprimas etwas zu. Die breite Melodie der Violinen, die Synkopen der Baßgeige verebbten. Der Cymbalspieler Bálint spielte allein.
Читать дальше