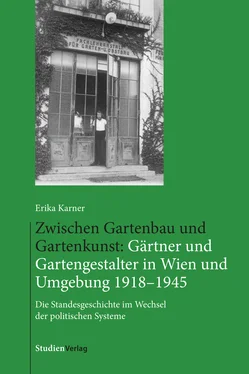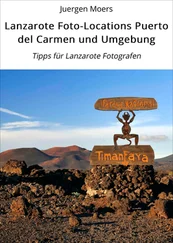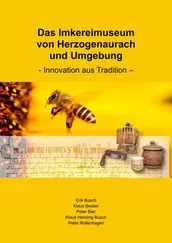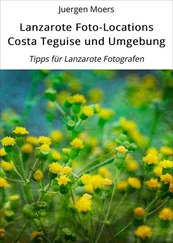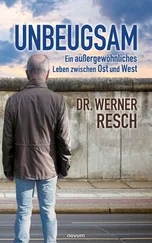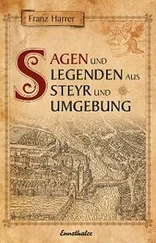Die restlichen Familienmitglieder – Vater Leopold, Mutter Berta und die Geschwister Hermine, Ernst und Josef – wurden am 19. Februar 1941 gemeinsam mit 999 anderen Personen vom Wiener Aspangbahnhof nach Polen, in die nördlich von Krakau gelegene Stadt Kielce deportiert. Dort wurde Ende März 1941 ein Ghetto errichtet, in dem Ende 1941 rund 27.000 Juden lebten. Nur 18 von den 1.004 im Februar 1941 deportierten Juden überlebten, 235 Mitglieder der Familie Knapp waren nicht darunter. 236
2.2.4 Auswirkungen des „Anschlusses“ auf die jüdische Bevölkerung
Zeitgleich mit dem Einmarsch Hitlers in Österreich kam es zu ersten Übergriffen auf die jüdische Bevölkerung. Von den in diesem Kapitel beschriebenen Auswirkungen waren selbstverständlich auch jüdische Gärtner, Gärtnereiarbeiter und Gartenbesitzer betroffen.
Der erzwungenen Auswanderung voran gingen „Arisierungen“ und Vermögensentzug. Die „Ausreisewilligen“ hatten Steuern, Umlagen und Abgaben zu entrichten. Die sogenannte „Judenvermögensabgabe“, nach den November-Pogromen 1938, wurde eingeführt. Alle staatsangehörigen Juden, die bereits aufgrund der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden vom 26. April 1938 ihr Vermögen hatten anmelden müssen, wurden für abgabepflichtig erklärt. 237 Mit 14. April 1938 war die im „Altreich“ geltende „Reichsfluchtsteuer“-Pflicht, 238 rückwirkend für alle seit dem 1. Jänner ausgewanderten Personen, auf die angeschlossene „Ostmark“ ausgedehnt worden. Sie belief sich auf 25 % des gesamten steuerpflichtigen Vermögens, wobei der letzte Steuerbescheid maßgeblich war. Schulden und Belastungen konnten vor der Berechnung der „Reichsfluchtsteuer“ vom Gesamtvermögen abgesetzt werden. 239 Die „Reichsfluchtsteuer“ sollte die vom Regime forcierte Ausreise nicht verhindern, in der Realität sah dies jedoch oftmals anders aus, da die zu zahlenden Beträge nicht aufgebracht werden konnten. 240 Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs änderte sich die Zielsetzung der antijüdischen Politik weg von der forcierten Ausreise hin in Richtung Planung und organisatorischer Vorbereitung der Ermordung der europäischen Juden. 241
Wien hatte 1938 rund 180.000 jüdische Einwohner, 242 diese Zahl verringerte sich bis Ende 1941 auf 43.266 Jüdinnen und Juden im Sinne der Nürnberger Gesetze; Ende 1942 lebten nur mehr 8.053 hier, alle anderen waren in den Selbstmord getrieben, vertrieben oder deportiert. 243 In Wien überlebten weniger als 5.700 Jüdinnen und Juden das „Dritte Reich“. 244
2.4.4.1 Arisierung, Vermögensentzug
Der Begriff „Arisierung“ war eine nationalsozialistische Wortneuschöpfung und bezeichnet im weitesten Sinn die Enteignung und Beraubung von Juden sowie deren Verdrängung und Vertreibung aus bestimmten Berufen und gesellschaftlichen und kulturellen Positionen. 245
„Arisiert“ wurden Unternehmungen, Geschäfte, Kapitalbesitz, Wohnungen, Haus- und Grundbesitz, Arbeitsplätze, Berufstätigkeiten und Ausbildungspositionen, Kunstgegenstände, Mobiliar, Musikinstrumente, geistiges Eigentum sowie Schmuck und andere Wertgegenstände. 246
Unmittelbar nach dem „Anschluss“ begannen in Wien der Terror und die Beraubungsaktionen gegen jüdische Geschäfts- und Privatleute durch SA-Männer. 247
Die Gier mancher Wiener und Wienerinnen beschränkte sich dabei nicht auf Plünderungen und „Hausdurchsuchungen“: Vielfach ernannten sich „wilde Kommissare“ zu Leitern in Firmen mit jüdischen Besitzern und „wilde Arisierungen“ griffen um sich. 248
Diese Ausbrüche „spontaner Volkswut“ wurden von der nationalsozialistischen Führung insofern toleriert, als sie für größere strategische Ziele instrumentalisierbar waren. 249 Sobald die Gefahr des Kontrollverlustes über den „Volkszorn“ drohte, wurde der Pöbel zur Ordnung gerufen. 250 Ein erster Versuch, Ordnung in die „spontanen“ Arisierungen zu bringen, war das Gesetz über die Bestellung von kommissarischen Verwaltern und kommissarischen Überwachungspersonen vom 13. April 1938. 251 Aber erst im Juli 1938 gelang es Gauleiter Bürckel mit Hilfe der von Reichsstatthalter Arthur Seyß-Inquart erlassenen Anordnung über kommissarische Verwalter, das Kommissarsunwesen endgültig unter Kontrolle zu bringen. 252
Der Historiker Hans Witek identifizierte mehrere Gruppen an „Arisierung“ interessierter Personen. Die erste Gruppe nannte er die „ ‚kleinen Ariseure‘, die sofort persönliche Vorteile realisieren wollten“ als zweite Gruppe „mittelständische Interessen, die auf die Ausschaltung von Konkurrenten und Übernahme der besten Geschäfte und Betriebe zielten“, als dritte Gruppe schließlich Industrie und Banken, die ebenfalls besitzstandweiternde Strategien verfolgten. 253
Eng mit der „Arisierung“ verknüpft waren verschiedene antijüdische Maßnahmen wie z. B. Einschüchterungen, sukzessive Entrechtung und Freiheitsberaubung, erzwungene Auswanderung bis hin zur Deportation und Vernichtung in Konzentrationslagern. 254 Auch die „Vermögensanmeldung“ zählte dazu.
Im Zusammenhang mit den Gärtnern sind die erfassten land- und forstwirtschaftlichen Vermögen von Bedeutung.
Der Schwerpunkt des in der Kategorie Land- und Forstwirtschaft mit der Vermögensanmeldung erfassten Vermögens lag auf landwirtschaftlichen Betrieben; Forst-, Weinbau-, Gärtnerei- und Fischereibetriebe waren bescheidene Größen innerhalb des erfassten Gesamtvermögens. Zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehörten neben Grund und Boden auch die zur Bewirtschaftung erforderlichen Gerätschaften. 255
Nach den offiziellen Zahlen lag der Anteil des Grundvermögens am gesamten angemeldeten jüdischen Bruttovermögen bei 22,7 %, der Anteil des land- und forstwirtschaftlichen Eigentums daran betrug hingegen nur 1,72 %. 256 Da ein Großteil der jüdischen Bevölkerung in Wien lebte, konzentrierte sich das wertmäßig bedeutendste Grundeigentum zu etwa 90 % auf Wien, während land- und forstwirtschaftliches Eigentum zum überwiegenden Teil außerhalb Wiens bzw. in Stadtrandlagen lag. 257 Selbst hier kann festgestellt werden, dass wertmäßig landund forstwirtschaftliches Vermögen mehrheitlich (47,49 %) im Wiener Stadtgebiet situiert war; der Rest verteilte sich auf die übrigen Bundesländer (41,04 %) und das Ausland (11,46 %). 258 1938 befanden sich 15 % aller Liegenschaften in Wien in jüdischem Besitz, wobei sich dieser Anteil ziffernmäßig versteht. Den höchsten Anteil an jüdischem Grundeigentum in Wien wiesen die Bezirke 1–3, 7–9 und 19–20 auf; in diesen Bezirken überschritt der ziffernmäßige Anteil 20 %. Der geschätzte Wertanteil jüdischen Grundeigentums in Wien lag bei 30 %. 259
Die am 18. Mai 1938 gegründete und im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit angesiedelte Vermögensverkehrsstelle (VVSt) wurde die staatliche Zentralinstanz der Enteignungspolitik. 260 Aufgrund einer unmittelbar nach dem „Anschluss“ erzielten Vereinbarung zwischen VVSt und Grundbuchgerichten konnte die VVSt erreichen, dass sämtliche Liegenschaftstransaktionen, an denen jüdische Vertragspartner beteiligt waren, nur mit ihrer Zustimmung grundbuchfähig wurden. 261
In Österreich wurde Ende August 1938 mit der „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“ eine eigene zentrale Dienststelle im Zusammenhang mit der erzwungenen Auswanderung geschaffen, die von Adolf Eichmann gegründet und bis zum Frühjahr 1939 von ihm geleitet wurde. Im Februar 1939 wurde der Aufgabenkreis der „Zentralstelle“ neuerlich erweitert und mit dem „Auswanderungsfonds Wien“ ein Instrument zur Übernahme und Verwaltung des Vermögens jüdischer „Auswanderer“ geschaffen. In den darauffolgenden Jahren wurde dem „Auswanderungsfonds Wien“ eine größere Anzahl von Liegenschaften in ganz Österreich „eingewiesen“. 262
Читать дальше