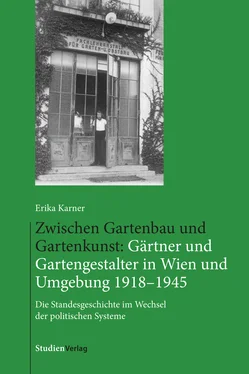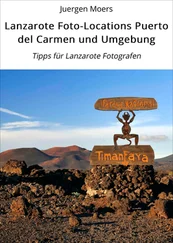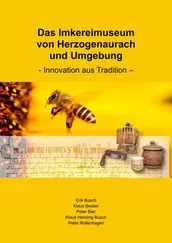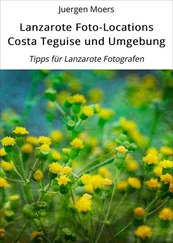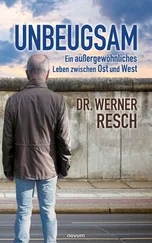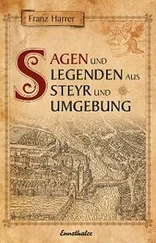Unmittelbare Auswirkungen auf die „arische“ Bevölkerung hatte der rasche Abbau der Arbeitslosigkeit. Betrug die Arbeitslosenrate 1937 noch 22 Prozent, so sank sie bis 1938 auf 12,7 % und betrug 1939 nur noch 3,7 %. Dieses „Beschäftigungswunder“ wurde durch die Abwanderung vieler Facharbeit ins „Altreich“, die Ausweitung der Bürokratie, die Vertreibung von politisch und rassisch Verfolgten aus dem Arbeitsprozeß und durch Rekrutierungsmaßnahmen für Armee und Arbeitsdienst erreicht. 187
Ein übergeordnetes Ziel des Hitler-Regimes war die Angleichung der österreichischen Wirtschaft an die Verhältnisse im „Altreich“. 1941 mussten jedoch führende Parteifunktionäre eingestehen, dass diese Angleichung trotz aller Bemühungen nicht gelungen war. 188
2.4.1 Nationalsozialismus in Wien
Das Verhältnis der neuen Machthaber zu Wien war ambivalent. So verkündete zunächst Bürgermeister Hermann Neubacher:
„Wir werden diese deutsche Stadt Wien nationalsozialistisch verwalten und wir werden diese deutsche Stadt Wien einem ungeahnten Aufbau zuführen, einem Aufbau, der der Kritik der Welt standhalten wird, und einer Ausgestaltung, über die als oberster, unvergleichlicher Bauführer unser Führer des deutschen Volkes und des Großdeutschen Reiches Adolf Hitler mit seiner ganzen wahrhaft königlichen Baugesinnung stehen wird.“ 189
Hitler meinte jedoch im Rahmen vertraulicher Tischgespräche, dass er zwar Wien bewundere, aber vorhatte, „Wiens Vormachtsstellung auf kulturellem Gebiet in den Alpen- und Donaugauen zu brechen und ihm einmal in Linz eine Konkurrenz erstehen zu lassen und zum anderen Graz so auszubauen, daß seiner von jeher nicht so sehr für Wien begeisterten Bevölkerung in kultureller Hinsicht der Rücken gestärkt werde“. 190
Bereits im Herbst 1938 kam es zur flächenmäßigen Ausweitung Wiens, es wurden zahlreiche Umlandgemeinden, wie z. B. Hadersdorf-Weidlingau, Liesing, Purkersorf, Rodaun, Mödling, Münchendorf und Schwechat eingemeindet. Insgesamt wurden 97 Gemeinden angegliedert, die Fläche der Stadt wuchs von 27.800 ha auf 121.800 ha und die Einwohnerzahl erhöhte sich um rund 213.000 auf 2.087.000 Personen. 191 Die neu geschaffenen Bezirke trugen die Nummern 22 bis 26. 192
Die vor dem „Anschluss“ existierenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Stadt, hauptsächlich die hohe Arbeitslosigkeit und die Wohnungsnot mit den daraus resultierenden Schwierigkeiten, sollten durch ein eigenes Wirtschaftsprogramm gelöst werden. 193 Dabei hatte der „Anschluss“ zu einer Erhöhung der Arbeitslosenzahl beigetragen: So war im April 1938 die Zahl der Stellensuchenden in Wien von 204.000 auf 235.000 gestiegen. Aufgrund der Vertreibungen, der anlaufenden Rüstungsindustrie und schließlich durch den Kriegsausbruch konnte die Arbeitslosigkeit bis Ende September 1941 in Groß-Wien auf 871 registrierte Arbeitslose gesenkt werden. 194
Das Wohnungsproblem konnte, trotz anders lautender Ankündigungen, nicht durch Neubauten gelöst werden, sondern es wurde durch die Deportation und Vertreibung der jüdischen Bevölkerung gemildert. 195
1939 avancierte Bürckel zum Gauleiter Wiens. Ihm waren auf politischer Ebene bis 1940 zwei große „Erfolge“ beschieden: „die völlige Zerschlagung Österreichs und der Aufbau der Reichsgauverwaltung sowie die Übernahme der Führung auch in der Wiener Gemeindeverwaltung“ . 196
2.4.2 Parteimitgliedschaft in der NSDAP
Da es unter den österreichischen Gartenarchitekten einige NSDAP-Mitglieder gab, ist es erforderlich, die Bedeutung der Mitgliedschaft und die Möglichkeiten der Erlangung einer Mitgliedschaft darzustellen.
In die NSDAP sollten, gemäß einem Ausspruch Hitlers, nur die besten Nationalsozialisten aufgenommen werden. 197
Nach der Machtübernahme in Deutschland stieg die Mitgliederzahl rasant von 850.000 im Jänner 1933 auf 2,5 Millionen im Frühjahr 1933 an. 198 Diese Flut von Neumitgliedern veranlasste die NSDAP-Führung im April 1933 eine Aufnahmesperre zu erlassen, die allerdings nicht für die Angehörigen der NSDAP-Jugendverbände galt. 199
Mit der von Reichsschatzminister Franz Xaver Schwarz erlassenen Anordnung 18/37 vom 20. April 1937 wurde eine Lockerung der Mitgliedersperre verfügt und gleichzeitig der Status des „Parteianwärters“ geschaffen: Er hatte alle Pflichten, insbesondere Melde- und Beitragspflicht, allerdings konnte er nicht alle Rechte eines ordentlichen NSDAP-Mitgliedes beanspruchen. Die „Parteianwärterschaft“ gab es nur im Zeitraum vom 1. Mai 1937 bis 1. Mai 1939. 200
Trotz der nach wie vor bestehenden Reglementierungen erlebte die NSDAP nach der Lockerung der Mitgliedersperre 1937 und der Einführung der „Parteianwärterschaft“ die größte Eintrittswelle ihrer Geschichte. Von Juni bis Dezember 1937 traten 783.466 Personen der NSDAP bei, von Dezember 1937 bis Juni 1938 stieg die Zahl der Aufnahmen mit 1.336.702 Neumitgliedern noch einmal erheblich an. Im Jahr 1939 wurden allein 171.484 Parteimitglieder aus der „Ostmark“ neu erfasst. 201
Die Freiwilligkeit des Beitritts zur Partei war oberstes Gebot, obwohl sich die örtlichen Stellen ab 1939 zunehmend unter Druck gesetzt fühlten, die Vorgaben Hitlers zu erfüllen, nach denen 10 % der Bevölkerung Mitglieder der NSDAP sein sollten. 202 Alle „Volksgenossen“, die deutsche Staatsbürger waren, einen guten Leumund und das 21. Lebensjahr vollendet hatten, konnten der Partei uneingeschränkt nur vom 1. Mai 1939 bis 2. Februar 1942 beitreten, da mit 2. Februar 1942 für die Dauer des Krieges eine totale Mitgliedersperre verhängt wurde. Ausgenommen davon waren nur Überweisungen aus den Reihen der Hitlerjugend. 203 Mit der Verordnung 24/44 verfügte Reichsschatzminister Schwarz, dass ab dem 31. Oktober 1944 keine Aufnahmeanträge, mit Ausnahme von Kriegsversehrten, mehr vorgelegt werden durften. 204
In Österreich wurde durch eine Verordnung der Bundesregierung vom 19. Juni 1933 jegliche Betätigung für die NSDAP verboten, was einem Verbot der Partei gleichkam. 205 Das Betätigungsverbot blieb formal bis zum Anschluss an das Deutsche Reich, genauer gesagt bis zur Bildung der nationalsozialistischen Bundesregierung am 11. März 1938, in Kraft, obwohl bereits vorher Vertrauensleute der illegalen NSDAP in führende Positionen des austrofaschistischen Ständestaates berufen worden waren. 206 Diese Periode wird in der NS-Terminologie auch als „Verbotszeit“ bezeichnet. 207
Im Dezember 1939, nach der Aufhebung der im März 1938 für den Gau Wien eingeführten totalen Mitgliedersperre, wurden die Wiener „Parteianwärter“ schrittweise, je nach Verdiensten und Wichtigkeit für die Partei, bis 1942 als Parteimitglieder aufgenommen. Zu einer früher angekündigten „allgemeinen Aufnahmeaktion“ kam es nicht, es wurden nur die bereits gestellten Ansuchen abgearbeitet. Danach galt auch hier die im Februar 1942 verhängte totale Mitgliedersperre. 208
1942 gab es auf dem Reichsgebiet des ehemaligen Österreich 688.478 NSDAPMitglieder, bei der Registrierung von NSDAP-Mitgliedern im Jahr 1946 ergab sich ein Mitgliederstand von 536.662. 209
In Wien gab es Ende 1938 rund 100.000 Parteimitglieder, von denen rund 23.000 „Alte Kämpfer“ und weitere 42.000 „Illegale“ waren. Bis 1942 stieg die Zahl der NSDAP-Mitglieder im nunmehrigen Groß-Wien auf rund 160.000 an und nach 1945 gab es laut Registrierung nur noch 115.000 Wiener Nationalsozialisten. Der Historiker Gerhard Botz führt diesen Mitgliederschwund auf Kriegs- und Wanderungsverluste zurück. 210
Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Definition der Begriffe „Alte Kämpfer“ und „Illegale“, die häufig verwendet werden und sich in Akten finden.
„Alte Kämpfer“, also Mitglieder der ersten Stunde, waren Personen, die bis zum Jahr 1928 der NSDAP beitraten und eine Mitgliedsnummer unter 100.000 hatten. Sie genossen Privilegien bei parteiinternen Sozialleistungen und durften das Goldene Parteiabzeichen tragen. 211
Читать дальше