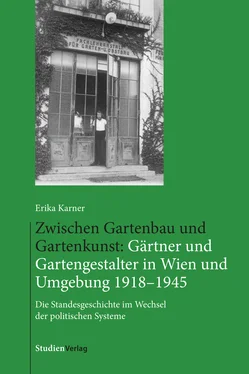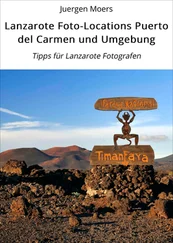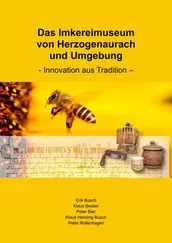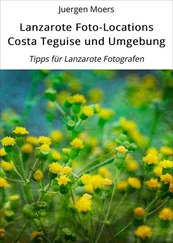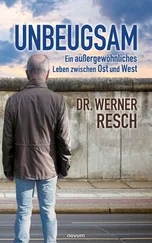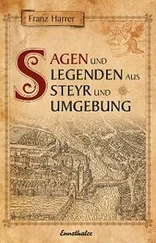1 ...8 9 10 12 13 14 ...26 Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, sprach eine Erwerbsgärtnerdelegation unter der Führung der christlich-sozialen Nationalräte Spalovsky und Volker beim Bundeskanzler Johann Schober vor und ersuchte um Unterstützung ihrer Anliegen, was dieser auch zusagte. 76 Dieses Versprechen änderte aber nicht viel an der Lage der Gärtnerschaft.
Die hereinbrechende Weltwirtschaftskrise verschlechterte die ökonomische Lage der Gärtnereien zusehends.
Neben den steigenden Arbeitslosenzahlen im Gartenbau machte sich die Wirtschaftskrise auf Seiten der Arbeitgeber bemerkbar. Den Gemüseproduzenten fiel es schwerer, ihre Waren zu verkaufen, da die Zahl der potenziellen Kunden sank, eine Absatzkrise machte sich breit und trotzdem stiegen die Gemüseimporte aus den Nachbarländern – dies verschärfte die Lage für die heimischen Gemüsegärtner zusätzlich. 77
Die Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre ging auch an den Gartenarchitekten nicht spurlos vorüber. Die Auftragslage war schlecht und viele der Gärtnereiinhaber und Gartenarchitekten mussten Ausgleich anmelden. Hier einige Beispiele von bekannten Gartenarchitekten:
Gartenarchitekt Wilhelm Debor: 78
Ausgleich eröffnet: 09.12.1929 – beendet 30.04.1930
Ausgleich eröffnet: 04.05.1931 – beendet 12.10.1931
Gartenarchitekt Albert Esch: 79
Ausgleich eröffnet: 26.09.1933 – beendet 19.02.1934
Gartenarchitekt Wilhelm Hartwich: 80
Ausgleich eröffnet: 07.11.1931 – beendet 24.03.1932
Gartenarchitekt Wilhelm Vietsch: 81
Ausgleich eröffnet: 26.10.1931 – beendet 23.03.1932
Selbst die weithin bekannte Rothschild-Gärtnerei in Wien litt an den Folgen der Weltwirtschaftskrise. Baron Alfons Rothschild war nach der erzwungenen Übernahme der Boden-Credit-Anstalt und der darauffolgenden Insolvenz seines Bankhauses, der Creditanstalt, gezwungen, die Kosten der Erhaltung der Gärten herabzusetzen, er musste Gärtner entlassen und Teile seiner Anlage auf der Hohen Warte schließen. 82 Ein bis zu diesem Zeitpunkt als Reservegarten zur Verfügung stehendes Gelände sollte parzelliert und verkauft werden. 83
2.2.2 „Rotes Wien“ versus „schwarze“ Bundesländer
Wien hatte von 1918 bis 1934 eine wirtschaftliche und politische Sonderstellung inne.
Die Stadt war während der Habsburger-Monarchie aufgrund ihrer Funktion als zentrale wirtschaftliche Schaltstelle zum Angriffspunkt der nationalen Unabhängigkeitsbewegungen geworden. Auf Wien lastete damit eine schwere Hypothek, zu der sich bald eine weitere – die der politischen „Andersartigkeit“ – gesellte. 84
Nach dem Wahlsieg der Wiener Sozialdemokratie 1919 kam es alsbald zu großen Spannungen „zwischen dem „roten“ Wien und den „schwarzen“ Bundesländern.“ 85
Mit dem Beschluss der Loslösung Wiens von Niederösterreich am 29. Dezember 1921 und seiner Konstituierung als Bundesland mit 1. Jänner 1922 ergab sich für Wien eine spezielle Konstellation. Der Bürgermeister Wiens erlangte nun zusätzlich die Rechte eines Landeshauptmanns und konnte nun eine eigenständige Sozial- und Wirtschaftspolitik betreiben. Die „rote“ Sozialdemokratie hatte dadurch die Möglichkeit, einen mächtigen Gegenpol zur „schwarzen“ konservativen Vorherrschaft auf Bundesebene zu bilden. 86
Wien erhielt ferner das nach der Verfassung den Ländern zustehende Steuerfindungsrecht. Ziel der Steuerpolitik des „Roten Wien“ war die Umverteilung von den oberen zu den unteren Einkommensschichten mittels der Besteuerung von Luxuskonsum. 87
Diese Eigenständigkeit Wiens brachte aber nicht nur Vorteile, sondern führte zu einer zunehmenden ökonomischen und politischen Isolierung der Stadt innerhalb Österreichs. 88
Die wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben der neuen Stadtregierung bestanden in der Belebung der Wirtschaft und der Linderung der Wohnungsnot durch die Bereitstellung gesunder und billiger Kleinwohnungen.
Die private Wohnbautätigkeit in Wien war nach dem Ersten Weltkrieg völlig zum Erliegen gekommen – dies gab den Anstoß zu den kommunalen Wohnbauprogrammen der Stadtregierung unter der finanzpolitischen Federführung von Stadtrat Hugo Breitner. Diese Programme bildeten den wichtigsten Nachfrageimpuls, für sie wurde vorübergehend mehr als ein Viertel der Gesamtausgaben im Stadtbudget bereitgestellt, sodass sie während der 1920er-Jahre den Schwerpunkt des Gemeindehaushaltes bildeten. 89
Neben dem kommunalen Wohnungsbau bildeten die Schulreform unter Otto Glöckel und die soziale Fürsorgepolitik unter Julius Tandler die drei Säulen der sozialdemokratischen Politik in Wien. 90 Darüber hinaus wurde diesen drei traditionellen Säulen der Arbeiterbewegung noch eine vierte, die „kulturelle Bildungsarbeit“, hinzugefügt. 91 In seiner kulturpolitischen Dimension wies das „Rote Wien“ weit über die ursprüngliche Dimension eines wohlfahrtsstaatlichen und sozialpolitisch inspirierten Modells hinaus und sicherte sich so auch die Unterstützung der Intellektuellen. 92
Während der Wirtschaftskrise Ende der 1920er-Jahre war der Haushalt der Stadt Wien mit bedeutenden Einnahmeverlusten konfrontiert und 1931 wurde zudem der Aufteilungsschlüssel der gemeinschaftlichen Bundesabgaben zum Nachteil Wiens geändert. Nach der Ausschaltung des Parlaments im März 1933 setzte die Regierung Dollfuß die finanzielle „Einschnürung“ der Gemeinde Wien fort und entzog ihr die Steuereinhebung der Bundesabgaben. Verzweifelt versuchte die sozialdemokratische Stadtregierung das entstehende Defizit zu begrenzen, wodurch die Wohnbautätigkeit der Gemeinde völlig zum Erliegen kam. 93
Die Historikerin Maren Seliger beschrieb zusammenfassend die Situation der Sozialdemokraten in Wien und deren Gegenmodell zur Politik der Bürgerblockregierung auf Bundesebene als Kulturkampf in dem „die laizistische Sozialdemokratie als Anwältin der Moderne“ galt und das bürgerlich-bäuerlich-feudal-katholische Lager eine in vormodernen Traditionen verhaftete antiliberale Bewegung darstellte. 94
Die während der ersten beiden Jahre der Republik durch die Sozialdemokratie beschlossenen Sozialgesetze verbesserten nicht nur die ökonomische Situation der Arbeiterschaft deutlich, sondern führten auch zu einer machtpolitischen Besserstellung der Arbeiterklasse.
Der sozialpolitische Erfolg bis 1920 war beachtlich: In über 80 sozialpolitischen Gesetzen und Verordnungen wurden wichtige Materien wie Achtstundentag, Arbeitslosenversicherung, Mieterschutz, Verbesserung des Kollektivvertragsrechts etc. geregelt. Österreich hatte damit beinahe alle sozialpolitischen Forderungen, die auf der im Spätherbst 1919 in Washington stattfindenden ersten internationalen Arbeitskonferenz aufgestellt wurden, erfüllt. 95
Der österreichische Sozialstaat rückte damit kurzfristig an die erste Stelle innerhalb Europas. Nachdem das Wirtschaftswachstum jedoch mäßig blieb, drängte die Unternehmerschaft auf Sozialabbau. 96
Die neuen sozialpolitischen Gesetze hatten auch für die in gewerblichen Gärtnereien arbeitenden Gehilfen Gültigkeit und stellten, zumindest auf dem Papier, eine deutliche Verbesserung ihrer arbeitsrechtlichen Situation dar.
Auch bei den Gärtnern drängte die „Unternehmerschaft“ auf Sozialabbau, und zwar in Form der von vielen angestrebten Zugehörigkeit des gesamten Gartenbaus zur Landwirtschaft. 97
Die Arbeitslosigkeit war ein die Erste Republik begleitendes Problem mit mehreren Ursachen. Zum einen gab es große strukturelle Schwierigkeiten, zum anderen trug die staatliche Wirtschaftspolitik zur niedrigen Beschäftigungsrate bei. 98
War die Zahl der Arbeitslosen kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges auf über 350.000 angeschwollen, so fiel sie in den beiden nachfolgenden Jahren deutlich auf 78.000 (1920) und 28.000 (1921). Diese sehr erfreuliche Entwicklung hielt jedoch nicht an und in den Jahren bis 1930 lag die Arbeitslosenrate zwischen 8,3 und 11,2 %, danach stieg sie sprunghaft an, lag 1932 bereits bei 21,7 % und erreichte 1933 ihren Höchstwert mit 26 %. Im Jahr 1937 lag die Arbeitslosenrate noch immer bei 21,7 % oder 464.000 Personen, von denen nur 231.320 Personen Arbeitslosenunterstützung erhielten – der Rest galt als „ausgesteuert“ und hatte somit keinerlei Unterstützungsanspruch. 99
Читать дальше