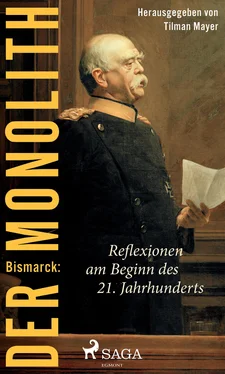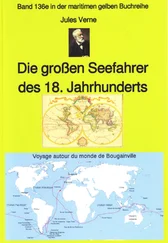Das nationalstaatliche Werk Bismarcks ist über die Katastrophe des 20. Jahrhunderts hinweg – strukturell-geografisch gesehen – noch immer, wenn auch in einer Schrumpfversion von 1990, wahrnehmbar. Es ist existent! Der deutsche Dualismus ist längst beendet, wenn auch um den Preis, dass Wien und Berlin nicht mehr zusammen gedacht werden können; sonstige dynastisch-reaktionäre Kleinstaatereien sind aber verschwunden. Die Okkupation nach 1945 hat das Land ebenso überstanden wie es einer glücklichen Fügung zufolge einer Morgenthauisierung entgangen ist; und sogar die Teilung der ganzen Nation war »nur« ein Transitorium. Deutschland hat durch seine Hybris, die mit dem Wilhelminismus begann, seine Größe verspielt und sich Bismarcks Maxime der Politik 43, sich zu bescheiden, versagt. Deutschland hat zur Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts beigetragen, doch es hat in der Mitte Europas überlebt und es würde gut daran tun, realpolitisch als Macht der Mitte Europas seinen Weg zu finden – getreu der Räson Bismarcks, sich nicht in Europa zu isolieren.
* * *
Bismarck – ein Monolith. Ein großes Wort. Als solcher erscheint er im Rückblick und aus der Ferne eigentlich auch als Unikat und Solitär. Bei näherer Betrachtung – Reflexionen – ändert sich der Eindruck ein wenig, steht er nicht allein, sondern eingebettet in Konstellationen und Bündnisse, war gar abhängig von Kooperationsbereitschaften vieler seiner Kollegen, denen er auch in seinen Erinnerungen ein Denkmal setzte.
Dennoch überragt Bismarck seine politische Klasse und seine Nachfolger; jedenfalls scheint es so, als ob seine große Gestalt noch im 21. Jahrhundert erkennbar ist und dazu einlädt, über sein Erbe nachzudenken.
Eine eigene kleine Abhandlung mit einer breiten politikgeschichtlichen Expertise legt Peter März vor. Seine biografische, porträtorientierte Studie einer amts- und wirkungsgeschichtlichen Betrachtung und seine komparativ akzentuierte Analyse von vier Kanzlerschaften liefern einen tragenden Baustein dieses Bandes. Der Vergleich der vier Kanzler Bismarck, Bülow, Adenauer und Kohl zeigt, dass man Bismarck vielleicht als einen Monolith ansehen kann, der sein eigenes Profil absolut besitzt. März spielt die bekannten Faktoren einer Kanzlerdemokratie zur Analyse der vier Matadore durch. Dabei erwähnt er die schwierige politische Doppelexistenz des preußisch eingebetteten Reichskanzlers, er diskutiert die Rolle und das Verhältnis des Militärs zu Bismarck, er arbeitet die Stellung Bismarcks zu Reichstagsmehrheiten heraus, auf die es dem Reichskanzler zum Regieren ankommen musste, und er skizziert die Entwicklung einer Art Reichskanzlei, mit der Politik betrieben wurde. Wichtig ist auch die Erwähnung, wie sehr Bismarck einen Präventivkrieg, also die in der Gesellschaft diskutierte Sorge um künftige militärische Unterlegenheit – die Situation von 1914 –, ablehnte.
Eine verfassungsgeschichtlich und ebenfalls politikgeschichtlich angelegte filigrane Abhandlung liefert Hans Fenske . Als Verfassungsexperte – auch im Sinne der Verfasstheit einer politischen Ordnung – zeigt er den Verfassungsgebungsprozess im zweiten Reich und zuvor des Norddeutschen Bundes auf. Er kann nachweisen, wie sehr sich Bismarck um diese Verfassungsgebung des Norddeutschen Bundes persönlich bemühte: 17 der 64 Artikel waren von Bismarck entworfen worden. Konstitutionelle Regierungssysteme waren auch in Europa verbreitet, ein parlamentarisches gab es der Sache nach nur in Großbritannien und Belgien, dennoch kann man nach Fenske den Norddeutschen Bund als den verfassungsmäßig modernsten Staat im damaligen Europa bezeichnen. Fenske ist auch der Ansicht, dass es ein drastisches Fehlurteil (Wehler) bedeute, wenn man das Deutsche Reich als eine pseudokonstitutionelle autoritäre Monarchie bezeichne, in der die Parteien ohnmächtig gewesen sein sollen. Auch von einer Kanzlerdiktatur zur Zeit Bismarcks könne wahrlich keine Rede sein.
Längst untergegangen ist der in der deutschen Geschichte lange Zeit bestimmende deutsch-deutsche Dualismus. Golo Mann sprach von der ersten Teilung Deutschlands 1866. Ulrich Schlie schreibt zum Datum 1866 einen spannenden Essay und hält einleitend fest, dass in einem einzigen Gefecht entschieden worden war, ob Deutschland künftig von Berlin oder von Wien aus regiert werden würde. Bismarck hat nach der österreichischen Niederlage Österreich zu gewinnen versucht, was sich im Laufe der Zeit bis zum Zweibund von Preußen und Habsburg, von Deutschland und Österreich entwickelt hat, dessen Verdichtung allerdings vor dem Ersten Weltkrieg zur Nemesis wurde. Zu Recht erwähnt Schlie auch den Wettbewerb zwischen dem System Metternich und dem System Bismarck, der zeitversetzt ausgetragen wurde. Der Einschätzung von Ulrich Schlie, dass die Beschäftigung mit der von Preußen und Habsburg geprägten Vergangenheit verpasste Gelegenheiten zutage treten lasse, kann nur zugestimmt werden. Preußen und Habsburg seien auf ganz unterschiedliche Weise zu Opfern ihrer eigenen Geschichte geworden.
Der Beitrag von Werner Plumpe über Bismarcks Sozialpolitik liefert den überraschenden Befund, der sich in der Fachliteratur abzeichnet: Der vielfach bemühte Zusammenhang von sozialpolitischer Gesetzgebung und Sozialistenverfolgung stelle eine oberflächliche Betrachtung dar. Bismarck sei es tatsächlich um einen umfassenderen Schutz vor Erwerbsunfähigkeit gegangen. Denn die sozialen Nöte seien sehr dringlich, die Kommunen mit den sozialen Problemen unmittelbar konfrontiert gewesen. Der Staat aber habe sich aus den Fragen der sozialen Sicherung herausgehalten, was nicht länger durchhaltbar gewesen sei. Insofern, so Plumpe, folgten die Maßnahmen der Sozialpolitik einer objektiven Logik und nicht einem Reflex an die sozialdemokratische Adresse. Es hat diesen Zusammenhang gegeben, aber er war viel loser. Bismarcks Intention war, dass sich jeder arbeitende Mensch durch Arbeit selbst erhalten können sollte und seine materiellen Interessen befriedigt werden sollten, was auch zur Stabilisierung der sozialen Ordnung beitragen würde. Bismarck wollte die Kosten der Sozialversicherung staatlicherseits aufbringen, während seine Gegner, insbesondere die der Sozialdemokratie, ihre politischen Vorfeldorganisationen (Hilfskassen) mit diesen Aufgaben befasst sehen wollten. Gegner der Gesetzgebung hatten also ihrerseits ein Interesse, zu behaupten, dass die Sozialgesetzgebung nur der Bekämpfung der Sozialdemokratie diente.
Dem Phänomen Junker widmet sich Heinz Reif in einer Rekonstruktion. Das Bild erfahre von Jahrzehnt zu Jahrzehnt eine immer aggressiver werdende Zuschreibung von Negativmerkmalen. Gerade der äußere Habitus dieses ostelbischen Ritterguts- und Militäradels trug zur Feindbildwerdung bei. Schon der Freiherr vom Stein hatte die Klasse als herzlos, hölzern und halbgebildet bezeichnet. Mit dem Junker wird seit dem 19. Jahrhundert das Bild verbunden: ein wenig bevölkertes Land, riesige stagnierende Gutswirtschaften, Kulturlosigkeit eines Koloniallandes. Als problematisch gilt, dass dieser Adelsstand im Militär und Beamtentum zeitweise überhand nahm. Hugo Preuß habe in den Junkern eine Gefährdung des Bürgertums gesehen, weil die Demokratisierung des Bürgertums aufgehalten wurde, ja es sich in Richtung einer Feudalisierung entwickelt habe. Bei Werner Sombart werde diese Feudalisierung des Bürgertums ebenfalls erwartet, als Selbstfeudalisierung. Bei Max Weber behindere diese sinkende Klasse durch ihre reaktionäre Politik die Dynamisierung der Gesellschaft. Franz Mehring spreche gar von einer monarchisch verschleierten Junkerrepublik in der man existiere. Wilhelm Röpke sehe in dem Junker einen Bauern mit Monokel, der charakterlich defizitär sei und dazu beitrage, das Preußen-Bild in Deutschland verhasster zu machen. Ein Reflex dieser Feindbildbestimmung finde sich in jeder Propaganda der Alliierten in beiden Kriegen, vor allen Dingen aber im zweiten, nach dem Preußen verboten wurde.
Читать дальше