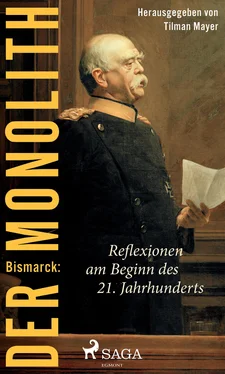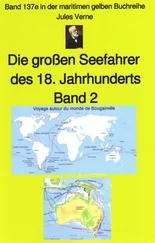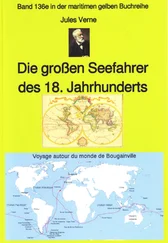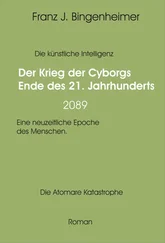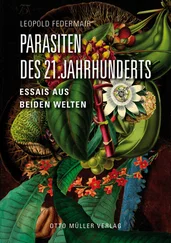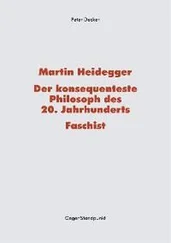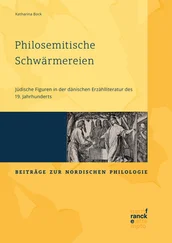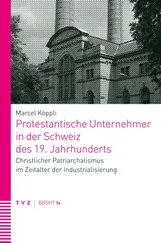In Süddeutschland hatten sich gegen Ende der 1860er-Jahre hin die Distanzierungsbemühungen gegenüber Preußen und dem Norddeutschen Bund verstärkt. In Bayern stürzte über die Jahreswende 1869 / 70 der preußenfreundliche Ministerpräsident Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst nach einer Landtagswahl, bei der in Gestalt der bayerischen »Patriotenpartei« das katholisch-konföderale Element die Mehrheit errungen hatte. Erst der Ausbruch des Krieges gegen Frankreich im Juli 1870, geschickt als Nationalkrieg gegen den »Erbfeind« inszeniert, schuf die psychologischen Voraussetzungen zur Überwindung der Mainlinie.
In den 1980er-Jahren schien nationale Einheit im geteilten Deutschland in weite Ferne gerückt. Die politischen und publizistischen Eliten in Westdeutschland hielten dieses Ziel zumeist für historisch überholt und für antieuropäisch. Helmut Kohl betrieb, dokumentiert in seiner Zehn-Punkte-Erklärung vor dem Deutschen Bundestag vom 28. November 1989, drei Wochen nach dem Fall der Mauer in Berlin, eine improvisierte Wiedervereinigungspolitik. Auf sie war man weder in den Bonner Ministerien und Fraktionen noch in den Redaktionen der meinungsbildenden Medien vorbereitet.
Es bleibt der große Unterschied, dass 1870 / 71 Krieg geführt wurde und viel Blut floss – über 100 000 Kriegstote auf französischer, über 40 000 auf deutscher Seite –, und dass 1989 / 90 in Europa kein Schuss fiel, sieht man vom Untergang des Ceauçescu-Regimes im Dezember 1989 in Rumänien ab. Und das wiedervereinigte Deutschland profilierte sich dann, wider alle unterstellten deutschen Unsicherheiten, als verlässlicher Teil der europäischen Integration. Das Deutsche Reich hingegen habe, so die vergleichende Kritik, als »halbhegemoniale« Größe in Europa mehr oder weniger isolierte Machtpolitik betrieben, mit dem schließlichen Fiasko des Ausbruches des Ersten Weltkrieges 43 Jahre nach der Reichsgründung. Derlei Vergleiche, zuungunsten Bismarcks und seiner Schöpfung, verleugnen aber die historischen Kontexte, die stets mit zu bedenken sind. Kriegführung galt im 19. Jahrhundert als sozusagen naturgegebenes Instrument der Politik. Alle europäischen Großmächte hatten daran Anteil, Frankreich dreimal, im Krimkrieg 1853 bis 1855, 1859 im oberitalienischen Feldzug gegen Österreich und schließlich 1870 / 71 im Krieg gegen Preußen-Deutschland. Dazu kam ein imperiales Abenteuer wie seine Intervention in den sechziger Jahren in Mexiko. Russland führte in dieser Phase zweimal Krieg, im Krimkrieg und gut 20 Jahre später gegen das Osmanische Reich. Mit blutigen Feldzügen integrierte es die Kaukasus-Region in sein Imperium. Die europäischen Konfliktlagen der Zeit hat Bismarck auf dem Berliner Kongress von 1878 zu entschärfen versucht. Entscheidender für eine faire Bewertung erscheint aber, dass er nach der Reichsgründung auf eine sehr ernsthafte Weise das Deutsche Reich für »saturiert« erklärte, künftige Kriege zwar nicht ausschloss, das war unter den Bedingungen der Zeit eben schlechthin unmöglich, wohl aber unbestreitbar bis zu seinem Ausscheiden aus dem Amt im März 1890 in bemerkenswertem Maße Friedens- und Sicherheitspolitik betrieb. Was ihn in seiner Politiktypologie eher von manchen Kanzlern – und zumal der amtierenden Bundeskanzlerin – der 1949 ins Leben getretenen Bundesrepublik unterschied, war ein stetes Bemühen um Optionen und Alternativen. Die Außen- und Sicherheitspolitik ist nur ein Beispiel dafür: Neben der Konstante des 1879 vereinbarten Zweibundes mit Österreich stand die Sorge auch um Stabilität in den Beziehungen zu Russland, zuletzt dokumentiert im Rückversicherungsvertrag von 1887. Und nahezu gleichzeitig lotete Bismarck in der Korrespondenz mit dem britischen Außenminister Salisbury die Möglichkeit für ein deutsch-britisches Bündnis aus. Das hätte zugleich bedeutet, dass Deutschland seine sehr autonome, »halbhegemoniale« Stellung aufgegeben und sich an die Flügel- und Weltmacht Großbritannien angelehnt hätte. Es war somit eine Politik, die jeweils weit entfernte Optionen prüfte und in Betracht zog.
Ähnliches gilt für die Innenpolitik. Auch hier spielte Bismarck stetig die verschiedensten Kombinationen durch. Stets galt es, mit »Alternativlosigkeit« zugleich Sackgassen zu vermeiden.
Bismarck war heftig, emotional, oft hasserfüllt. Zugleich konnte er charmant und werbend sein. Auch diejenigen, die ihm sehr oft mit guten Gründen politisch, gesellschaftlich oder kulturell fern standen, waren sich sehr im Klaren darüber, dass er ein Großer war. Im Nachruf Alfred Kerrs vom 4. August 1898 hieß es: »Am Sonntagmorgen wußte man, daß er tot war. […] In dieser Sekunde fühlt man, mag eine Art Hass die Grundempfindung gegen ihn gewesen sein, wie tief man ihn immer grollend geliebt hat. Ein Stück von Deutschland ist es, das in den Fluten des Weltgeschehens für alle Ewigkeit versank.« 78Bismarck bleibt ein Thema, für die »Berliner Republik« vermutlich mehr als für die alte Bundesrepublik.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.