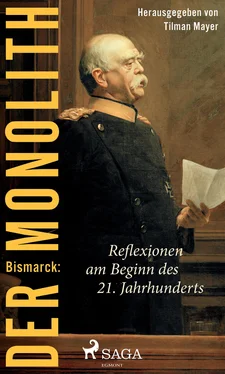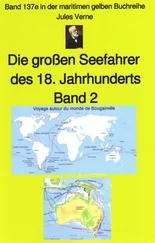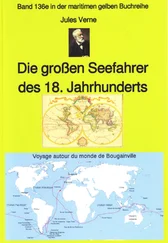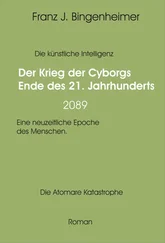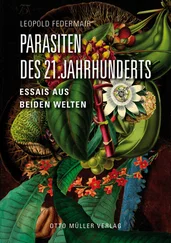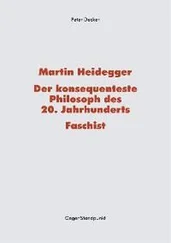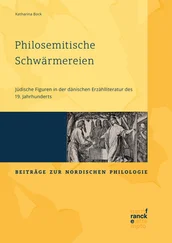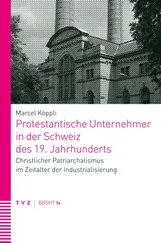Berühmt ist eine weitere Episode, bei der er im Nachhinein kräftig an seiner Heldenrolle feilte. Es geht um die Zugfahrt des preußischen Hauptquartiers nach Ausbruch des Krieges gegen Frankreich im Sommer 1870 von Berlin an den Rhein. Bismarck schreibt darüber in seinen Memoiren: »Schon bei der Abreise nach Köln erfuhr ich durch einen Zufall, daß beim Ausbruch des Krieges der Plan festgestellt war, mich von den militärischen Berathungen auszuschließen. Ich konnte das aus einem Gespräch des Generals von Podbielski mit dem Grafen Roon entnehmen, dessen unfreiwilliger Ohrenzeuge ich dadurch wurde, daß es in einem Nebencoupé stattfand, dessen Scheibenwand von einer breiten Oeffnung über mir durchbrochen war.« 57Im preußisch-deutschen Hauptquartier von Versailles eskalierte dann der Konflikt zwischen Bismarck und dem Generalstab im Dezember 1870. Man gewinnt fast den Eindruck eines kleinen Krieges mit Papier und Tinte vor dem Hintergrund des großen Krieges am Belagerungsring um die französische Hauptstadt. Bismarck attackierte Generalstabschef Moltke, und es kann kein Zweifel daran sein, dass er in dieser Auseinandersetzung der offensivere, der heftigere, ja der um Einschüchterung bemühte Teil war. Die Militärs fürchteten um die Einheitlichkeit des Oberbefehls und die Stringenz ihres professionellen Vorgehens. Der Kanzler, ganz dem Primat des Politischen verhaftet, wollte eine möglichst schnelle Kriegsbeendigung durch militärische Eskalation, damit nicht andere europäische Akteure, Großbritannien oder Russland, auf den Plan traten. Das hieß: Artillerieeinsatz gegen Paris, Verschärfung der Kriegsführung wie der Okkupationspolitik in den besetzten Regionen; dem Generalstab unterstellte er ein Übermaß an Rücksichtnahme gegenüber dem Gegner, es reichte bis hin zu der Annahme, daran seien die aus Großbritannien stammende Gattin des Kronprinzen, Prinzessin Victoria, wie die familiären britischen Verbindungen von Generalstabschef Moltke schuld. Für die Kriegführung selbst vertrat Bismarck die Auffassung, »unmittelbar auf die französische Armee selbst einwirken und einen heilsamen Schrecken verbreiten würde es, wenn es möglich wäre, die Truppen Eurer Majestät daran zu gewöhnen, daß weniger Gefangene gemacht und mehr die Vernichtung des Feindes auf dem Schlachtfeld ins Auge gefaßt würde.« 58Auf eine knappe Formel gebracht war die Position des Leiters der preußischen Politik: Härtere, verlustreichere Kriegführung zur schnellen Beendigung der Feindseligkeiten, um weitergehende politische Verwicklungen zu verhindern.
Die Schwebelage zwischen Politik und Militär in Preußen-Deutschland ist oft beschrieben worden. Für die spätere Bismarckzeit, das heißt die Jahre nach der Reichsgründung, kann man zunächst eindeutig davon ausgehen, dass der Kanzler die Kompetenzkompetenz fest in Händen hielt, gegenüber den Militärs vermutlich nicht weniger als gegenüber den Parlamentariern. Das hing zusammen mit seinem Prestige, wobei er die Generalstäbler weiterhin nervte, mit der eher diplomatischen Grundhaltung des Generalstabschefs von Moltke, der Konflikte nicht auf die Spitze trieb, sondern gegebenenfalls einen Schritt zurücktrat, und mit der Konfliktbereitschaft des Kanzlers gegenüber dem Monarchen. Darüber hinaus gab es eine ganze Reihe von politischen Festlegungen, die den Militärs durchaus ganz in ihren Kram passten, an erster Stelle die bündnispolitische Grundsatzentscheidung durch den Zweibund mit Österreich-Ungarn von 1879.
Um hier ein Zwischenfazit zu ziehen: Der Kanzler und mit ihm die Sphäre der Politik waren durchaus stärker, die Sphäre des Militärischen damit eher schwächer beziehungsweise eher weniger übergriffig, als es in manchem Klischee vom preußisch-deutschen Militärstaat den Anschein hat. Man muss aber auch hinzufügen: Diese Gewichtung war weniger strukturell bedingt als durch Rolle und Bedeutung der konkreten Akteure.
Es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu: Bismarck agierte seinerseits beachtlich in die Sphäre des Militärischen hinein: Das ging bei Rüstungsfragen bis in technische, ja physikalische und ballistische Details. Ähnlich wie bei der Steuerpolitik 59zeigte sich Bismarck auch bei der Rüstungspolitik von einer verblüffenden Detailkenntnis. Der in seinen jungen Jahren gescheiterte Verwaltungsbeamte, gescheitert, weil ihn die administrative Filigranarbeit langweilte, wurde auf seine älteren Tage zum Faktenhuber. Und auch in seinem Falle galt: Wissen ist Macht. In der Rüstungspolitik gerierte sich Bismarck, ganz patriarchalisch-fürsorglich, als so etwas wie der gute Hausvater der Armee. Soldaten bräuchten zweckmäßige, wärmende Kleidung, und vor allem bräuchten sie leistungsfähige, international wettbewerbsfähige Infanteriewaffen. Die 1870er- und 1880er-Jahre waren eine Zeit mehrfacher Umrüstungen und Quantensprünge bei den europäischen Armeen. Grundlegende technische Weiterentwicklungen folgten vor allem beim Infanteriegewehr aufeinander, zunächst vom Vorder- zum Hinterlader, dann zum Repetiergewehr und schließlich zum Gewehr mit rauchlosem Pulver und geringerem Kaliber, das mit höherer Rasanz schießen konnte. Bismarck zeigte beziehungsweise gerierte sich hier als der besorgte Experte, der die professionellen Experten förmlich vor sich her trieb. Dazu kokettierte er mit seinen Kenntnissen als passionierter Jäger. Beim rauchlosen Pulver, das einen Quantensprung bei der Infanteriebewaffnung darstellte, kommunizierte er eng mit dem Fabrikanten Max Duttenhofer, an den staatlichen Instanzen vorbei. Duttenhofer behauptete, höhere Qualität als staatliche Fabriken herstellen zu können. 60Ganz persönlich beteiligte sich der Kanzler sogar an der Auseinandersetzung um die Frage, wie lange man welches Schießpulver funktionsfähig lagern könne und wann durch Feuchtigkeit Unbrauchbarkeit drohe. Modern gesprochen: Das war das Gegenteil eines Generalisten, das war Detailverliebtheit.
8. Ruhestand und Selbststilisierung
Von den vier hier kursorisch betrachteten Kanzlern verlor nur einer sein Amt durch eine Wahlniederlage, Helmut Kohl 1998. 108 Jahre zuvor war die Niederlage des Bismarck-Kartells bei der Reichstagswahl unbestreitbar ein beschleunigendes Moment für seinen Abgang, aber nicht unmittelbar und nicht in einem formalen Maße zwingend. Aber von den Vieren, Bismarck, Bülow, Adenauer und Kohl, scheint nur Letzterer einigermaßen in Frieden aus dem Amt geschieden zu sein. Er hatte eine beispiellose Agenda auf der Habenseite, mit der niemand, er auch nicht, bei Antritt seiner Kanzlerschaft 16 Jahre zuvor hatte rechnen können: den Vollzug der deutschen Wiedervereinigung und die Weiterführung der europäischen Integration in einem Maße, das jedenfalls er als historisch ebenso notwendig wie legitimiert ansah. Kohl blieb im Geschäft; die Funktion des Ehrenvorsitzenden der CDU, die ihm wie selbstverständlich zugefallen war, interpretierte er durchaus politisch. Beim Europäischen Rat vom 11. Dezember 1998 avancierte er zum »Ehrenbürger Europas«. 61Dann riss mit einem Mal die Spendenaffäre, gemessen am historischen Zäsurcharakter der Phase vom Fall der Mauer in Berlin bis zur Entscheidung für die Einführung des Euro, eine Fußnote, Kohl medial-kommunikativ in den Abgrund. Und als er sich davon politisch einigermaßen erholt hatte, beraubten ihn körperliche Gebrechen weitgehend der Fähigkeit, seine historische Rolle selbst vital darzustellen. Anders sein Vorgänger Helmut Schmidt. Schmidt, dem wortgewandten Mitherausgeber der Wochenzeitung Die Zeit , stand und steht die ganze mediale Zunft der Elbmetropole zur Verfügung. Sie schreibt ihn je länger, desto intensiver zum Staatsmann und Intellektuellen von singulärer Urteilskraft hoch. Es dauert vermutlich lange, bis der deutschen Gesellschaft allmählich wenigstens in Teilen dämmern wird, dass dabei vielfach die Grenze zur peinlichen Hagiographie überschritten wird. 62
Читать дальше