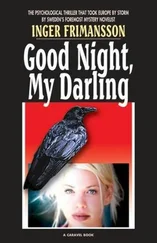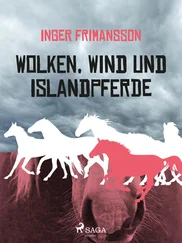Außerdem war sie nur einmal im Jahr gezwungen, dem Tankwagenfahrer zu begegnen. Sie stellte die Whiskyflasche jeweils vor das Kellerfenster, verziert mit einem gekräuselten Papierband.
»Vielen Dank für das Öl«, schrieb sie auf einen kleinen Zettel, auf den sie die Flasche stellte. Der Zettel lag anschließend immer noch da, und die Tinte hatte begonnen, sich aufzulösen.
Im Keller stand auch jener altertümliche Waschzuber, den Flora unbedingt weiterbenutzen wollte. Zweimal im Monat machte sie dort unten große Wäsche, Tage, an denen sowohl Justine als auch ihr Vater schlechter Laune waren. Flora machte sich dann hässlich, und es hatte den Anschein, als genieße sie es geradezu, sich in ein abstoßendes Waschweib zu verwandeln. Sie band sich ein Tuch um die Haare und trug jenen nach Staub stinkenden, gemusterten Kittel, an dem mehrere Knöpfe fehlten. Sie durchlief eine Art umgekehrter Aschenputtelverwandlung, und ihre Finger hinterließen brennende, feuchte Abdrücke auf Justines Wangen.
Der Flur war winzig, aber trotzdem mussten sie hier ihre Hüte und Mäntel aufbewahren. Überhaupt gab es nur wenig Kleiderschränke. Als Erwachsene hatte sie sich manchmal darüber gewundert, dass sich Papa, bei seinem Vermögen, dazu entschlossen hatte, in einem so kleinen Haus zu bleiben, selbst wenn es direkt am Mälarsee lag. Es hatte etwas mit ihrer Mutter zu tun, mit etwas Nostalgischem.
Justine hatte Floras Mäntel und den Blaufuchspelz weggeräumt, alles in große Plastiksäcke gestopft, Papas Lodenmantel, seine Mützen und Hüte hatte sie in einen anderen Sack gelegt. Sie war fest entschlossen gewesen, das Ganze zu Emmaus oder Humana zu bringen, aber in letzter Minute hatte sie es sich anders überlegt und die Sachen in den Keller getragen. Der Gedanke, irgendwo auf der Straße einer unbekannten Frau zu begegnen, die Floras Pelz trug, erfüllte sie mit großem Unbehagen, Es war, als würden die Augen ihrer Stiefmutter sie dann aus dem fremden Gesicht anschauen, sie zum Rückzug zwingen.
Gleich rechts vom Flur ging das blaue Zimmer ab, das sie als Esszimmer benutzt hatten. Alles war dort blau oder weiß, der dicke Teppichboden, die Samtvorhänge, das Fensterbrett mit den Usambaraveilchen und Browallia. Die Pflanzen hatten nicht überlebt. Sie hatte alle gut getränkt, bevor sie fuhr, und Tüten aus braunem Karton über sie gestülpt. Es hatte nichts genützt.
Der Vogel dagegen hatte keine Not gelitten. Sie ließ ihn auf dem Speicher hausen, dort konnte er sich nicht verletzen. Sie hatte ihm Schüsseln mit Körnern und Wasser und einen ganzen Korb mit geschälten Äpfeln hingestellt. Er hatte sich ein paar schöne Tage gemacht.
Sogar in der Farbgebung der Bilder dominierte Blau, Winterlandschaften, Segelboote und ein gewebter Wandbehang aus dünnen Seidenfetzen, der die ganze Schmalwand einnahm. Justines Mutter hatte ihn gewebt, lange bevor Justine geboren wurde. Er hatte immer dort gehangen, war wie ein Teil ihrer selbst.
An ihre Mutter erinnerte sie sich nur bruchstückhaft:
Ein prasselnder Regenschauer, ein Stück Stoff, unter dem sie und die Mutter zusammengekauert saßen, durchnässte Strümpfe, die sich an ihren Zehen festsaugten.
Ein Duft von pelzigen Blumen, etwas Heißes mit Honig.
Widerwillig hatte ihr Vater erzählt.
Sie war beim Fensterputzen. Es war das Fenster zum Wasser hin, im ersten Stock, an einem Tag mit scharfen Konturen aus grellem Sonnenlicht und dem sirrenden Gesang der Meisen. Windstill war es, das Eis lag noch in der Bucht, hatte aber begonnen, brüchig zu werden, und vielleicht freute sie sich darüber, vielleicht trällerte sie vor sich hin im flutenden Sonnenlicht, vielleicht hatte sie daran gedacht, anschließend, sobald sie fertig war, hinauszugehen und sich eine Weile auf den Balkon zu setzen, das Gesicht gen Himmel gewandt. Sie hatte dieses typisch nordische Ritual des Genießens sehr schnell übernommen. Sie stammte aus Annecy, einer kleinen Stadt in Frankreich in der Nähe der Schweizer Grenze, und er hatte sie gegen den Willen ihrer Eltern von dort als seine Braut entführt.
Es war ein Donnerstag. Er war sieben Minuten nach vier heimgekommen. Da lag sie auf dem Boden neben dem Fenster, die Arme ausgestreckt wie eine Gekreuzigte. Er sah sofort, dass nichts mehr zu machen war.
»Wie sieht man das?«, fragte Justine. Sie war in einer Phase, in der sie fast schon besessen war von dem Wunsch, so viel wie möglich über ihre Mutter zu erfahren.
Er konnte nicht antworten.
»Vielleicht hat sie doch noch gelebt. Wenn du sofort einen Arzt gerufen hättest, wäre sie vielleicht noch zu retten gewesen.«
»Mach mir bitte keine Vorwürfe«, sagte er, und es zuckte ein wenig um seine Mundwinkel. »Wenn du irgendwann selbst einmal einen Toten siehst, wirst du verstehen, was ich meine.«
Zuerst hatte er geglaubt, sie wäre von der Leiter gefallen und hätte sich etwas Lebenswichtiges gebrochen. Aber die Obduktion ergab, dass in ihrem Gehirn ganz einfach eine Ader geplatzt war, durch die ihr Leben verronnen war.
»Ein Aneurysma!«
Jedes Mal, wenn sie sich während Justines Kindheit darüber unterhielten, was geschehen war, sprach er das Wort langsam und überdeutlich aus.
Sie machte sich manchmal Sorgen, es könne erblich sein.
Sie fragte ihn nach sich selbst.
»Wo war ich denn, Papa, was habe ich gemacht?«
Er erinnerte sich nicht.
Sie war erst drei Jahre alt gewesen, als es geschah, drei Jahre und ein paar Monate. Wie reagiert eine Dreijährige darauf, wenn ihre Mutter von einer Leiter stürzt und stirbt?
Sie musste irgendwo im Haus gewesen sein, musste geschrien und geweint haben.
Auch wenn sie nicht verstanden hatte, was geschehen war, musste sie die vollkommene Verwandlung der Mutter entsetzt haben.
Ab und zu erwachte sie von einem Traum. Davon, dass ihr Stirnbein schmerzte wie nach langem und heftigem Weinen. Sie betrachtete sich dann im Spiegel und sah, dass die Augenlider geschwollen und die Augen glasig waren.
Fragmente einer Beisetzung, Fragmente aus Lehm und aus Blumen, die nie geduftet hatten.
Ein Vater, der auf dem Eis stand und schrie.
Im Album sah sie Bilder der Frau, die ihre Mutter gewesen war. Das fremde Gesicht ließ sie eigenartig kalt. Dichtes, nach hinten gekämmtes Haar, an den Seiten gelockt, Justine war ihr nicht einmal ähnlich.
Es lag eine Distanz in den Augen dieser Frau, die schlecht mit ihren eigenen Vorstellungen von ihr in Einklang zu bringen war.
Eine steile und enge Treppe führte in die obere Etage. Hier oben hatte die Mutter gestanden und Fenster geputzt. Links lagen die Schlafzimmer, rechts öffnete sich der Flur zu einem Wohnzimmer mit Aussicht auf die Lambarinsel und über den Mälarsee. Bücherregale bedeckten die Wände, nur wenige Möbelstücke: eine Musikanlage, ein länglicher Glastisch und zwei Sessel.
Sie gehörten Papa und Flora.
Justine waren mehrmals große Summen für das Haus geboten worden. Die Makler ließen nicht locker, stopften Prospekte in ihren Briefkasten, riefen sogar von Zeit zu Zeit an. Einer von ihnen war besonders aufdringlich. Er hieß Jakob Hellstrand.
»Sie könnten ein paar Millionen für den Kasten bekommen, Justine«, schwadronierte er und benutzte ihren Namen, als wären sie eng befreundet. »Ich habe einen Kunden, der das Haus umbauen will, er hat immer schon von dieser Lage geträumt.«
»Es tut mir Leid, aber ich glaube, daraus wird nichts.«
»Warum denn nicht? Denken Sie einmal darüber nach, was Sie für das Geld alles bekommen könnten. Eine allein stehende Frau wie Sie, Justine, Sie sollten nicht hier draußen in Hässelby hocken und verstauben, kaufen Sie sich stattdessen eine Wohnung in der Stadt und fangen Sie endlich an, richtig zu leben.«
»Sie wissen wohl kaum, ob ich richtig lebe oder nicht. Vielleicht tue ich das ja schon längst?«
Читать дальше