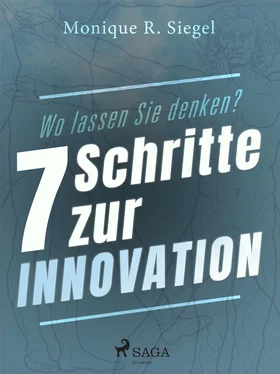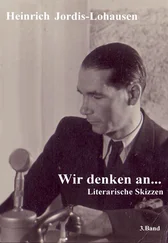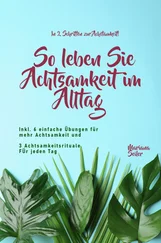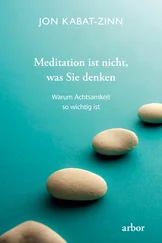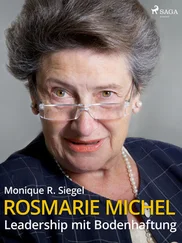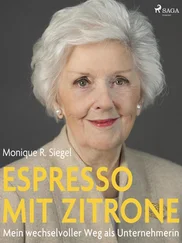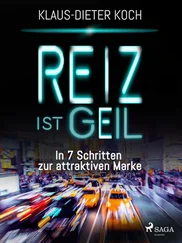Der Hirnforscher und Psychologe Dr. Edward de Bono, weithin als führende Autorität auf dem Gebiet des Denkens angesehen, legt die Basis dieser «Kulturkrankheit» offen: Westliches Denken geht zurück auf die griechischen Philosophen Sokrates, Platon und Aristoteles, die «Gang of Three», wie er sie nennt. Von diesen Autoritäten, die vor rund 2400 Jahren lebten, haben wir gelernt, alles Neue generell kritisch zu hinterfragen (Sokrates), die Suche nach der Wahrheit ad absurdum zu betreiben, um dennoch nie richtig daran zu glauben zu können, dass wir sie gefunden haben (Platon), oder – dafür sind wir ganz besonders begabt – kritisch-argumentativ an Neues heranzugehen (Aristoteles). Dem anderen zu beweisen, dass er sich irrt, ist wichtiger geworden, als seine Ideen unvoreingenommen zu prüfen. (Irre ich mich, oder haben Sie jetzt gerade Ihre Stirn gerunzelt? Dann denken Sie mal an die Rechtsprechung, besonders die amerikanische, wo es oft nicht mehr darum geht, jemandem seine Schuld nachzuweisen, als vielmehr der Gegenpartei einen Fehler zu beweisen.)
| The «Gang of Three» |
|
| Sokrates (469–399 v. Chr.) |
• Alles hinterfragen |
| Platon (427–348 v. Chr.) |
• Suche nach Wahrheit |
|
• Misstrauen |
|
• Kritisches Denken |
| Aristoteles (384–322 v. Chr.) |
• Urteilen, kategorisieren |
|
• Systematisieren |
|
• Entweder/Oder |
|
• Recht haben |
Dieses Denken – so Herbert Pietschmann , Professor für theoretische Physik an der Universität Wien, der Manager lehrt, ihre westliche Form des logischen Denkens zu begreifen – mag 2000 Jahre lang genügt haben, bis sich im 17. Jahrhundert Wissenschaftler daran machten, neue allgemein gültige Regeln zu finden. «Wissenschaftliche Rationalität ist also sinnvoll – die Frage ist nur, ob wir auch weiterhin ausschließlich mit dieser Art des Denkens arbeiten wollen.» Er plädiert dafür, eine «neue europäische Rationalität» zuzulassen, in der «ein Widerspruch oder ein Konflikt kein Fehler, sondern eine Chance für Weiterentwicklung [ist]». Und auch er sieht darin eine Aufgabe fürs Management: «Widersprüche müssen gepflegt werden. Schwierig ist nur zu unterscheiden, welche Widersprüche ganz einfach Fehler und welche notwendig zur Weiterentwicklung sind. Und das herauszufinden, ist die Aufgabe des Managers.» 4
Wenn etwas nicht in unser Denkschema passt, sind wir sehr gut in der Abwehr. Alle reden von Change, kaum jemand will sich aber wirklich damit auseinander setzen. Wie viel Energie wird täglich eingesetzt, um jemandem zu beweisen, dass seine/ihre Idee nicht realisierbar ist! Querdenker werden in vielen Stelleninseraten gesucht; wehe ihnen aber, wenn sie mit ihrem anderen Denken anfangen und damit die meisten ihrer Kollegen und Vorgestzten nerven! Die gängige Einstellung ihrer Umwelt ist: «Hier kommt etwas Neues. Überzeugen Sie mich, dass ich das brauche.» Wie viel Mehrwert – und Wertschöpfung ist ja eines der wichtigsten Anliegen in einer börsenorientierten Wirtschaft – liegt jedoch in einer anderen Denkweise:
Hier kommt etwas Neues.
Welchen Wert, welche Chancen kann ich darin erkennen ?
Innovation entsteht nun mal nicht aus «mehr vom selben», aus Kopieren des Gehabten. Nicht umsonst heißt ein amerikanischer Kalenderspruch: «Die gleiche Sache auf immer die gleiche Weise machen und trotzdem andere Ergebnisse erwarten – das ist die beste Methode, um beim Arbeiten verrückt zu werden.» 5 Merke: Karikaturen, Kalendersprüche und Bürowitze werden nur dann von jesder und jedem im Betrieb begriffen, wenn sie sich auf den herrschenden Normalzustand beziehen … Aufgabe der Unternehmen und Organisationen – denn NGOs, kirchliche oder kulturelle Institutionen brauchen Innovation genauso dringend wie «die Wirtschaft» – wäre es, den dafür nötigen Freiraum zu schaffen. Das passiert nur in seltenen Fällen, am ehesten wohl dann, wenn Not herrscht: an Manpower, an Geld, an Zeit. Das hat der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth erfahren, der unter großem Erfolgsdruck stand, als er sich entschloss, der Politik Adieu zu sagen und fortan als Top-Sanierungsmanager des einstmals berühmten Unternehmens Zeiss Jena zu wirken.
In einem Interview zum Thema «Kreativität in Wirtschaft und Politik» äußerte er sich zu den Anfängen seines neuen Laufbahnabschnitts: «In der Wirtschaft können Sie sich Kreativität am besten leisten in einem Unternehmen im Umbruch wie dem, in dem ich gelandet bin. Wenn sowieso alles durcheinander ist, lässt man auch unkonventionelle Ideen gelten. Wir haben einen riesigen Vorteil: Unsere Tradition ist weg – wir können nicht die Vergangenheit analysieren und darauf aufbauen. Was uns geblieben ist, sind technologisches Know-how und Menschen, die hoch motiviert sind. Und wenn Sie denen Impulse geben, haben Sie gute Chancen. Insofern habe ich also ein Umfeld, in dem ich mir Kreativität leisten kann. Und diejenigen, die glauben, sie sich nicht leisten zu können, werden sie sich leisten müssen, weil sie sonst das Innovationstempo nicht durchhalten werden.» 6
Das sind Gedanken, die ein gutes Jahrzehnt später nichts an Brisanz und Gültigkeit verloren haben, weil sie offensichtlich nicht von einer genügend großen Anzahl deutscher Politiker und Manager beherzigt worden sind. Lothar Späth ist zwar als Prestige-Referent zu Höchsthonoraren an vielen Veranstaltungen zu hören, aber auch er scheint weitestgehend ein Rufer in der Wüste zu sein. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends befinden wir uns in einem anderen, für Deutschland besonders dramatischen Wirtschaftsumfeld; vielleicht kann der Rufer jetzt eher auf ein Echo hoffen, wenn er über seine Erfahrung mit Kreativität und Innovation spricht.
Was wir in unserem europäischen Erziehungssystem, auf das wir ja so stolz sind, unter anderem nicht lernen, ist eingehende Exploration und gezielte Evaluation neuer Ideen; Denken als «skill», als universell einzusetzende Währung auf der Suche nach neuen, tragfähigen Lösungen, wird nirgendwo gelehrt. De Bono spricht von «recognition thinking»: Wir sind ach-so-gut in der Analyse – bis hin zur Paralyse, wie wir wissen. Das heißt, wir begnügen uns mit dem Identifizieren von Standardsituationen, denen wir mit Standardantworten begegnen. Darum sind wir in dem, was wir mit «Ausbildung» bezeichnen, in Bezug auf Technik und Technologien sehr gut, in Bezug auf Denken jedoch cirka 300 Jahre hinterher. Die Vergangenheit lässt sich allenfalls erklären (Analyse), die unbekannte Zukunft hingegen muss gestaltet werden (Design). Rechthaberei, Selbstüberschätzung und Angst vor möglichem Versagen lassen uns eher in der Vergangenheit graben als in die Zukunft denken. Andere Kulturen handhaben das anders: Für Inder zum Beispiel heißt «Forschen nicht Wissen sammeln, sondern mit dem Unbekannten jonglieren und mit dem Nichtwissen tanzen», wie es ein Inserat einmal so poetisch ausgedrückt hat.
Denken als sinnliches Vergnügen
Denken als sinnliches Vergnügen also, als Erfindergeist, als Entdeckerfreude, so wie uns zum Beispiel Bertolt Brecht hier seinen Galileo präsentiert. «Ich glaube an den Menschen, und das heißt, ich glaube an seine Vernunft!», sagt der Forscher zu seinem Freund. «Ja, ich glaube an die sanfte Gewalt der Vernunft über die Menschen. Sie können ihr auf die Dauer nicht widerstehen.» Und euphorisch setzt er hinzu: «Das Denken gehört zu den größten Vergnügungen der menschlichen Rasse.» Der Wissenschaftler, der das sagt, ist ein Mann des 17. Jahrhunderts, das, von der Renaissance infiziert, dem Zeitalter der Aufklärung entgegenstrebt. Der Stückeschreiber, der ihn das sagen lässt, ist ein ebenso besessener Denker gewesen: Denken war für Brecht ein sinnliches Vergnügen, vielleicht das sinnlichste überhaupt – und das will bei ihm etwas heißen, denn in Sachen Sinnlichkeit war er ein absoluter Gourmand.
Читать дальше