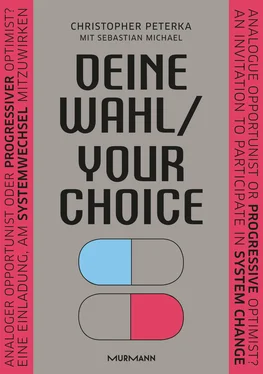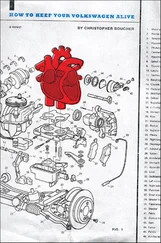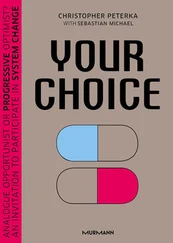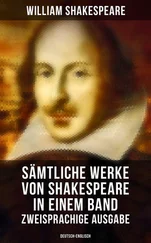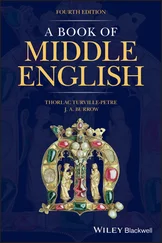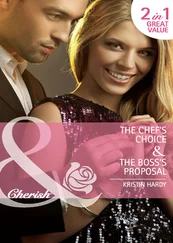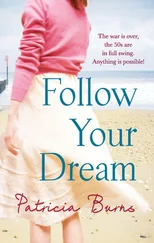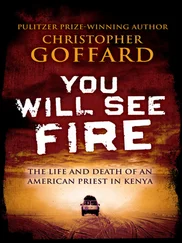Das Wasser wird trüber und alles noch komplexer, wenn kommerzielle Interessen und staatliche Überwachung auf erklärte Ideologien und implementierte Kontrolle über den Datenverkehr treffen.
Sagen wir mal, ich gehe nach China mit meinem Laptop oder Smartphone und entdecke, dass ich weder Google noch andere gewohnte und für mich wichtige Dienstleistungen nutzen kann. Was kann ich tun? Na ja, ich kann eine kleine Software herunterladen, die ein Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) erzeugt, das mir erlaubt, einen virtuellen »Tunnel« unter Chinas Firewall hindurchzugraben und so zu tun, als wäre ich woanders. Wahrscheinlich funktioniert das eine Weile ganz gut, aber: Wer besitzt das VPN? Kann ich ihm wirklich meine Daten anvertrauen? Wer versichert mir, dass die Leute, die mir meinen kleinen persönlichen Tunnel bereitstellen, mit den Leuten, unter deren Mauer ich hindurchgraben will, nicht unter einer Decke stecken?
[IST ES NOCH MÖGLICH, PRIVAT ZU SEIN? UNSICHTBAR?]
Oder ich gehöre zu einer Gruppe von Leuten, die in großen Teilen der Welt diskriminiert werden. Zum Beispiel die LGBT-Community. Im Juli 2019, zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Buches, gibt es immer noch 69 Länder auf der Welt, die Homosexualität gesetzlich einschränken oder verbieten. Wenn du in eines dieser Länder reist, wird dein Onlineprofil eventuell nicht nur zum Hindernis, etwa weil du kein Visum bekommst, es könnte auch zur existenziellen Bedrohung werden, zum Beispiel weil du verhaftet und angeklagt oder von einer Meute verprügelt wirst.
Was genau bedeutet es für mich, in einer Welt zu sein, in der meine virtuelle und körperliche Existenz nicht trennbar sind? Bedeutet es, dass ich, um sicher und halbwegs frei zu sein, mehrere Profile erstellen muss? Entspräche dies einer multiplen Persönlichkeit? Wie würde ich das überhaupt anstellen? Schau dir zum Beispiel dein Facebook-Profil, dein Amazon-Konto und deine Apple-ID an: Sie sind alle ein Teil desselben Korbs an Vermögenswerten, den deine Person darstellt. In vielerlei Hinsicht tragen sie dazu bei, dass es im digitalen Zeitalter so bequem ist, du zu sein. Das Ganze ist eine Sache der Funktionalität: Allein die Tatsache, dass ich für eine ganze Reihe von Apps, ob Einkauf, Dating oder Sonderdienstleistung, mein Facebook-Profil nutzen kann, um mich einzuloggen, macht alles so einfach. Es ist brillant. Und auch das, was mich digital unmöglich von meiner Online-Identität unterscheiden lässt.
Das führt uns zu dem Punkt, dem wir bisher ausgewichen sind – die Privatsphäre. Ist es in Anbetracht all dieser Umstände immer noch möglich, privat zu sein? Unsichtbar zu sein? Wenn wir es wollen? Wollen wir überhaupt noch privat sein? Und wenn ja, wer soll diese Privatsphäre schützen? Welche Gesetze können nicht nur meine Privatsphäre, sondern auch meine grundlegendsten Menschenrechte schützen?
Die Verquickung von virtueller und realer Sphäre hat es völlig unmöglich gemacht, zu erkennen, wer was kontrolliert, wer die Regeln bestimmt, wer sie befolgt und wer sie schlichtweg ignoriert. Wir haben einen Dschungel verzweigter Interessen, verschachtelter Kompetenzen und diffuser Verantwortlichkeiten erschaffen und das Ganze in etwa so gut reguliert wie den Wilden Westen. Kein Wunder, dass wir in der Patsche sitzen.
Was wir also brauchen, ist ein umsichtiges, differenziertes und diszipliniertes Management der digitalen Infrastruktur und Organisation. Nicht um irgendjemandem Kontrolle darüber zu geben, sondern um für einen angemessenen Grad an digitaler Hygiene zu sorgen, eine gesunde Welt, in der Beziehungen transparent sind und in der wir als Bürger und Gemeinschaft einen Schutz unserer Rechte erfahren und unser körperliches und digitales Wohlergehen garantiert wird.
[WIR BRAUCHEN EINE CHARTA, DIE GESETZLICH DIE INTEGRITÄT UND DAS WOHLBEFINDEN ALLER VERANKERT.]
Dazu gehört die Klärung der Frage, was möglich und was vertretbar ist. Gibt es für das, wozu wir technisch in der Lage sind, auch eine ethische Rechtfertigung? Mit jedem Schritt unserer technologischen Evolution haben wir uns genau diese Frage stellen müssen, am gründlichsten bei der Kernforschung. Obgleich dieses Dilemma bei weitem nicht neu ist, erreicht es uns schneller als zuvor und ist vielleicht jetzt auch komplexer. Die Atombombe wurde und wird bis heute zur Abschreckung verfügbar gehalten: Wenn man genug Zerstörungskraft auf Knopfdruck abrufbereit hält, um die gesamte Zivilisation zu vernichten, dann traut sich auch dein Gegner nicht, sein Potenzial einzusetzen – verfügbar gehalten. Ein hochriskantes Kalkül, das bisher aber scheinbar aufgeht. Die heute notwendigen Entscheidungen scheinen allerdings weit weniger eindeutig und offensichtlich, dabei jedoch nicht weniger wichtig.
Wenn wir ein regelndes, ethisches, anwendbares Rahmenkonzept fordern, das unsere Menschenrechte als digitale Bürger definiert und schützt, dann stellt sich natürlich die Frage: Wer soll diese Aufgabe erfüllen? Wer entwirft welche Art Charta und unterschreibt sie? Wer stellt sicher, dass die »digitalen Superstaaten« – GAFATA und wer immer im Laufe der nächsten Jahre als globaler Spieler dazukommt – sich daran halten?
Wir behaupten, dass sie selbst es sein müssen. Nicht isoliert, sondern in engem Verbund mit den G20 und den Vereinten Nationen.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – der bis heute größten von Menschen ausgelösten Katastrophe – von den Vereinten Nationen verabschiedet. Sie war der erste Versuch, auf globaler Ebene die grundlegendsten Rechte, die alle Menschen unabhängig von Nationalität, Abstammung, Glaubensrichtung oder politischer Überzeugung haben sollten, in Worte zu fassen. Sie hat den Grundstein für viele Bürgerrechts- und Gleichberechtigungsbewegungen gelegt, die in der Nachkriegszeit ins Leben gerufen wurden.
Heute brauchen wir eine Charta, die gesetzlich das Wohlbefinden und die Integrität für alle Netzwerkbeteiligten verewigt und alle mächtigen Parteien – seien sie Nationalstaaten oder globale Konzerne – verpflichtet, sie zu respektieren, zu schützen und aktiv zu fördern.
Dass dies ein globales Unterfangen sein muss, ist klar. In einer global vernetzten und verbundenen Welt werden globale Werte immer wichtiger, nicht nur weil Menschen über die begrenzenden Horizonte ihres eigenen Ursprungs und ihrer Wohnorte hinwegblicken können und wollen, sondern auch weil wir in eine immer globaler werdende Kultur eingebettet sind. Heißt das, dass wir unsere lokalen und regionalen Identitäten aufgeben müssen?
David Goodhart, ein britischer Journalist und Autor, Gründer und Redakteur des Prospect Magazine , hat eine klare Unterscheidung zwischen »irgendwo« und »überall« formuliert.
»Irgendwo«-Menschen sind Leute, die durch ihren Job, ihre Familie und Freunde, ihre emotionalen Bindungen und wirtschaftlichen Einschränkungen an einen Ort gebunden sind. Sie sind tendenziell weniger gebildet und schätzen, wie er sagt, »Gruppenbindung, Vertrautheit und Sicherheit«. »Überall«-Menschen dagegen können tatsächlich überall sein: Sie sind typischerweise gut gebildet und entweder Single oder in einer Beziehung ohne weitere Verantwortung dafür, oder sie haben eine Familie, die sie mitnehmen können. Sie können in Barcelona leben und ihren Laptop zur Arbeit nach Berlin tragen, ein paar Tage mit Freunden in Hongkong verbringen, einen Freelance-Job in Delhi übernehmen und sich dann übers Wochenende in New York erholen – ganz wie es ihnen gefällt. Solange sie ihre Internetverbindung haben, sind sie funktionsfähig; und ihr Blick auf die Welt, ihr soziales Netzwerk und ihre Arbeitsbeziehungen reflektiert das. Laut Goodhart schätzen sie »Autonomie, Offenheit und Fluidität«.
Wir vermuten, dass viele von euch, die das hier lesen, »Überall«-Menschen sind. Wir sind es gewiss. Goodhart erklärt weiterhin, dass »Überall«-Menschen – zumindest in England – nur etwa ein Viertel der Bevölkerung ausmachen, aber über verhältnismäßig viel Einfluss und Macht verfügen, unabhängig davon, auf welcher Seite des politischen Spektrums sie sich befinden. Er weist darauf hin, dass die politische Vernachlässigung, die die »Irgendwo«-Menschen erlebt haben, sie zur Wahl des Brexits geführt haben. Und das Gleiche kann sicherlich für die Wahl Trumps in den Vereinigten Staaten gesagt werden.
Читать дальше