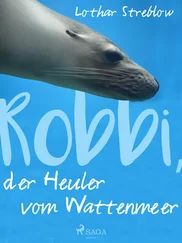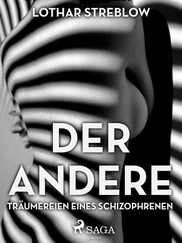Wie gebannt blieb Ruscha sitzen. Sie merkte gar nicht, wie ihre Mutter verschwand und kurz darauf mit Silm wiederkam. Mit weit geöffneten Augen musterte sie die sonderbare Welt außerhalb der Höhle. Das alles sah so ganz anders aus als im Wohnkessel. Und es roch auch anders.
Zwar hatte die Dämmerung schon eingesetzt, aber noch war es hell genug. Der See schimmerte wie ein matter Spiegel durchs Gebüsch. Bäume und Sträucher am Ufer warfen riesige Schatten. Grashalme und Blütenkelche wippten im Abendwind. Und dicht vor Ruschas Nase krabbelte ein großer schwarzer Käfer.
Ruscha fiepte leise. Diese Welt war ihr unheimlich. Ängstlich drückte sie sich an den warmen Leib ihrer Mutter. Die Fähe jedoch richtete sich auf den Hinterbeinen auf und schnupperte sichernd in den Wind. Verblüfft starrte Ruscha zu ihr hoch. So hatte sie ihre Mutter noch nie gesehen.
Silm aber knurrte und zwickte seine Mutter ungeduldig in den Schwanz. Jetzt ließ sich die Fähe wieder auf die Vorderpfoten herab, doch sie legte sich nicht hin. Langsam ging sie weiter. Und die Jungen folgten ihr, zögernd und noch ein bißchen wackelig, denn sie waren das Laufen nicht gewohnt. So machten sie ihre ersten Schritte ins Unbekannte.
Ruscha hielt sich dicht bei ihrer Mutter, krabbelte unbeholfen über Wurzeln und bemooste Steine. Seltsame Gerüche drangen ihr in die Nase. Und die Geräusche fremder Tiere erschreckten sie. Aber sie folgte tapfer ihrer Mutter.
Verwundert blickte sie sich um. Mäuse rannten quietschend in ihre Löcher, als sie die drei Otter kommen hörten. Ein Igel tapste gemächlich durch raschelndes Laub; ihn interessierten die Otter nicht. Und aus der Tiefe des Waldes tönte der unheimlich klingende Ruf eines Waldkauzes.
Ein Geräusch jedoch übertönte alles andere: ein murmelndes Plätschern. Die Fähe hatte waldeinwärts einen kleinen Bogen geschlagen und näherte sich nun dem Bachufer. Von hier führte eine Otterspur zum Waldbach zwischen Sumpfgräsern und Schilf. Nur eine Stelle nahe einem von der Strömung abgeschliffenen großen Stein, hinter dem sich das Wasser in einer flachen Mulde sammelte, lag frei. Doch weiter ging die Fähe nicht.
Inzwischen war es fast dunkel geworden. Am wolkenlosen Himmel zeigten sich die ersten Sterne. Silm stupste seiner Mutter energisch gegen den Bauch. Auch Ruscha spürte Hunger. Und ihre kleinen Pfoten taten weh vom Laufen.
Die Fähe wußte, was ihren Kindern fehlte. Sie wandte sich zurück zum Bau. Und es war nicht nötig, die Kleinen in den Wohnkessel zu tragen. Sie fanden ihren Weg allein durch die Röhre: zuerst Silm, dann Ruscha. Und erst in der warmen Geborgenheit der Erdhöhle gab es Milch.
Als die nächste Abenddämmerung anbrach und die Fähe den Bau verließ, warteten die Kleinen ungeduldig auf ihre Rückkehr. Endlich hörten sie draußen ein Geräusch. Doch die Fähe kam nicht, um sie zu holen. Sie blieb oben vor dem Eingang der Röhre. Und immer wieder stieß sie ein lockendes Fiepen aus.
Ruscha antwortete mit einem Winseln. Sie wußte nicht recht, was sie tun sollte. Und sie wollte geholt werden. Silm aber begann, ungestüm den Luftschacht hinaufzuklettern. Zwar rutschte er vor lauter Eifer mal ein Stück zurück, doch er schaffte es. Dann hörte Ruscha ihn oben schmatzen.
Das war zuviel für Ruscha. Sie hatte Hunger. Und sie begriff: Nur oben gab es etwas zu futtern. Vorsichtig setzte sie ihre kleinen Pfoten in den schrägen Gang, krabbelte dem hellen Schimmer entgegen. Schnaufend schob sie ihren Kopf aus der Röhre und schnupperte. Es roch gut hier: nach feuchtem Gras und vor allem nach Fisch.
Silm knabberte bereits eifrig an einer Äsche. Daneben lag ein kleiner Flußkrebs. Jetzt kam Ruscha vollends aus der Röhre heraus und beschnüffelte den Krebs, erwischte dabei aber nur eine Schere. Das roch appetitlich, doch mit dem harten Zeug konnte sie nichts anfangen. Sie wollte lieber ein bißchen von der Äsche probieren.
Ihr Bruder jedoch war dagegen. Knurrend versuchte er, den Fisch wegzuziehen. Ruscha fiepte verzweifelt. Jetzt griff die Fähe ein. Sie zerrte die Äsche zu sich und zerlegte sie geschickt in kleine Happen. So bekam auch Ruscha ihren Teil. Der Fisch schmeckte ihr. Nur die Gräten ließ sie liegen; die konnte sie noch nicht knacken. Und nach dem Fisch durfte sie noch ein wenig Milch nuckeln.
Auch Silm bekam seine Milch. Aber satt war er immer noch nicht. Kaum hatte seine Mutter ihm die Zitze entzogen, tappelte er zu dem Fischkopf und knabberte daran herum. Aber da war nicht mehr viel zu holen. Und den Krebs mochte er nicht.
Danach sah Silm etwas sonderbar aus. Fischschuppen hafteten an seinem braunen Fell rund um die kleine Schnauze und an seinen Pfoten. Zum Putzen aber hatte er offenbar keine Lust. Er war faul und schläfrig. Und während seine Mutter ihn sorgfältig leckte, knurrte er leise vor sich hin.
Als die Fähe mit Silm fertig war, nahm sie sich Ruscha vor. Und Ruscha knurrte nicht. Sie mochte das Putzen. Und ein wenig hatte sie selbst schon ihre Pfötchen geleckt und auch den Schnurrbart.
Die Dämmerung war inzwischen dichter geworden. Ein feiner Nebel lag über dem See. Gerade wollte die Fähe ihre Kleinen in den Bau zurückscheuchen, um selbst auf Jagd zu gehen, da drang vom nahen Bachufer ein Geräusch herüber. Sichernd erhob sich die Fähe auf die Hinterpfoten. Sie witterte Gefahr. Und auch Silm und Ruscha hoben ihre Köpfe.
Irgend etwas bewegte sich zwischen Schilf und Sumpfgräsern. Dann glitt ein großer Nachtvogel über das Weidengesträuch und strich waldeinwärts davon. Aber da war noch etwas anderes: etwas großes Schlankes, das mit schlangenhaften Bewegungen auf sie zukam.
Neugierig tappelte Silm dem Unbekannten entgegen. Doch seine Mutter packte ihn unverhofft beim Genick. Und Ruscha lief ihr nach. Jetzt erkannte sie das sonderbare Wesen, das sich schattenhaft gegen das Dämmerlicht abhob. Es sah aus wie ihre Mutter, nur ein wenig größer.
Verdutzt blieb Ruscha stehen. Sie hörte das ärgerliche Knurren ihrer Mutter, die sich mit Silm in der Schnauze zwischen sie und das fremde Tier schob. Der Otterrüde zögerte, wirkte unentschlossen. Doch als die Fähe den kleinen Silm ins Gras setzte und den Otter wütend anfauchte, schlug er einen Bogen und verschwand in Richtung zum Seeufer. Und von dort ertönte sein Pfiff.
Die Fähe antwortete nicht. Sorgsam geleitete sie ihre Jungen zum Bau. Aber sie kam nicht mit hinein. Sie wartete nur, bis sie einer nach dem anderen in den Wohnkessel gekrabbelt waren. Dann folgte sie dem Rüden zum See.
Tage und Nächte vergingen mit Schlafen, Futtern und Spielen. Die beiden jungen Otter wuchsen heran, balgten sich mitunter schon futterneidisch und lernten die Umgebung rund um den Bau allmählich immer besser kennen. Und jetzt nahm ihre Mutter sie schon öfter mit zum Ufer des Sees und des Waldbachs.
Als die Fähe ihre Kinder an diesem Abend aus dem Bau rief, gab es nach dem Putzen nur ein wenig Milch. Silm protestierte mit heftigem Knurren, doch nirgendwo lag etwas zu knabbern. So trottete er mit hungrigem Magen folgsam hinter seiner Mutter und Ruscha her.
Diesmal ging die Fähe auf dem Otterpfad direkt zum Bach. Der Abendwind rauschte leise im Schilf. Und das Wasser gluckste über den Rand des großen Steins. Hier hielt die Fähe an. Dann glitt sie geräuschlos ins Wasser, tauchte kurz unter und schwamm mit eleganten Bewegungen ein Stück bachaufwärts.
Verblüfft starrten die beiden Jungen ihr nach. Noch nie hatte ihre Mutter sie draußen allein gelassen. Und Ruscha begann leise zu fiepen.
Mit einemmal schnellte die Fähe mit dem Kopf aus dem Wasser. In der Schnauze trug sie eine kleine Äsche. Aber sie kam nicht zurück ans Ufer, legte den Fisch vielmehr an den Rand des großen Steins. Und sie lockte ihre Kinder.
Читать дальше