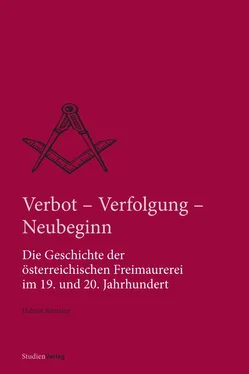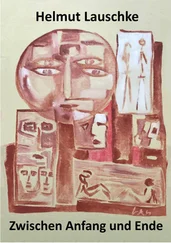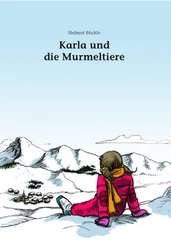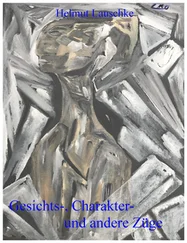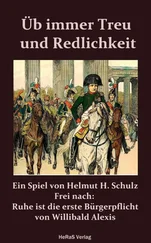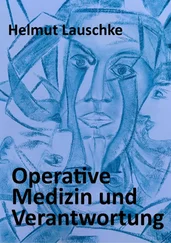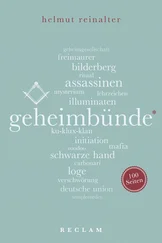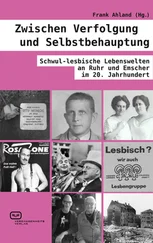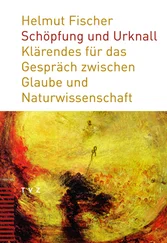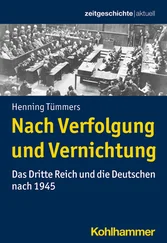Wenn die Historiographie auf die Einsichten des Konstruktivismus ernsthaft eingeht, so müsste dies auch Konsequenzen auf die Konzeption des Gegenstandsbereichs der Geschichte haben. Wenn Realität auf die Ebene der Beschreibung verlagert wird, dann ergibt sich daraus, dass neben den faktischen Ereignissen auch deren Wahrnehmung durch die Zeitgenossen in das Blickfeld des Historikers rückt. Ideologien, Werte, Normen, Einstellungen und Gefühle werden zwar heute von der Mentalitäts- und Alltagsgeschichte genauer untersucht, doch gilt der Status der „perzipierten Wirklichkeit“ gegenüber der tatsächlichen geschichtlichen Wirklichkeit solange als sekundär und subsidiär, wie die Erkennbarkeit des objektiven historischen Geschehens nicht grundsätzlich bezweifelt wird. Aus konstruktivistischer Perspektive wird in diesem Zusammenhang vor allem betont, dass durch verzerrte Wahrnehmungen, durch Vorurteile und durch aus heutiger Sicht überholte Theorien Ansichten der Zeitgenossen als kognitive Wirklichkeit gesehen werden, auch dann, wenn neue Forschungen ein anderes Bild dieser Wirklichkeit entwerfen. 77
Solche Unterschiede zwischen der Sicht der Akteure in der Geschichte und dem Geschichtsmodell, das ein Historiker heute von den gleichen geschichtlichen Ereignissen konstruiert, werden sehr verschieden bewertet. Die an mentalitäts- und alltagsgeschichtlichen Themen interessierte Historiker/innen entscheiden sich z.B. bewusst für die Wirklichkeitssicht der Zeitgenossen als historischen Forschungsgegenstand, weil sie auch der Perzeption von Wirklichkeit historische Realität zusprechen. Sozial- und Wirtschaftshistoriker/innen wiederum beurteilen verzerrte und uniformierte Ansichten von Zeitgenossen kritisch bis abschätzig. In einer konstruktivistischen Geschichtswissenschaft verstehen sich die jeweiligen Forschungsergebnisse gleichermaßen als Konstrukte des/der Historikers/in und können sinnvoll aufeinander bezogen werden. Die Perspektiven sind komplementär, weil die Konstrukte, die sich auf die Wirklichkeitssicht der Zeitgenossen beziehen bzw. die Modelle, die Historiker/innen von geschichtlichen Ereignissen entwerfen, zunächst lediglich unterschiedliche Gegenstände beschreiben. Allerdings wird dabei die jeweilige Wirklichkeitsperzeption der Handelnden stark aufgewertet, weil ihnen eine Realität sui generis zugeschrieben wird. Bei der Differenzierung zwischen der faktischen Ebene der Geschichte und der historischen Wirklichkeitsperzeption der Beteiligten stellt sich die Frage, ob historische Theorien die Wirklichkeitssicht der Zeitgenossen oder die historischen Umstände erfasst werden. Mit Hilfe sozialwissenschaftlicher und historischer Methoden können zwar Hypothesen entwickelt werden, welche Ursachen beispielsweise eine Wirtschaftskrise hatte und in welchem Ausmaß gesellschaftlicher Aufstieg in bestimmten Berufen möglich war. Die Entscheidungen von einzelnen Personen, bestimmte Berufe zu ergreifen, können aber besser durch konstruktivistische Konzepte der Ideengeschichte geklärt werden.
Wolfgang J. Mommsen hat 1988 betont, dass eine Rekonstruktion der mentalen Horizonte und Weltbilder der Akteure sehr wichtig sei, um die Zielsetzung von Handlungen besser zu verstehen. 78 Dieser Auffassung ist zuzustimmen, weil die Beschäftigung mit Theorien, Modellen, Methoden und dem Wissensstand, mit denen Menschen in verschiedenen historischen Epochen umgingen, stärker in den Bereich der Geistes- und Mentalitätsgeschichte gehört.
Die Gründung der Neuen Geschichtswissenschaften ist eng mit der „Historischen Sozialwissenschaft“ verbunden, ein Begriff von Hans-Ulrich Wehler, der zur Umschreibung eines neuen geschichtswissenschaftlichen Paradigmas dient und der sich kritisch gegen traditionelle Geschichtsschreibung wendet. Auch der Schule der „Annales“ kommt hier große Bedeutung zu. Die Historische Sozialwissenschaft untersucht in erster Linie Strukturen und Prozesse als Bedingungen und Folgen von Ereignissen, Entscheidungen und Handlungen. Diese Richtung beruft sich auf den deutschen Soziologien Max Weber 79 , insbesondere auf dessen Gesellschaftsbegriff und erachtet die Anwendung theoretischer Modelle im Sinne von „Idealtypen“ als notwendig. Die Historiographie wird hier als eine spezifische soziale Wissenschaft verstanden. Die Wissenschaftlichkeit misst sich demnach an der Fähigkeit, Ereignisse mit Hilfe von idealtypischen Begriffen zu erklären. 80 Als Lucien Febvre und Marc-Bloch 1929 in Straßburg eine Zeitschrift gründeten, waren ihre Motive sehr vielfältig. Die Geschichtsschreibung sollte aus ihrer Routine und inneren Erstarrung herausgeführt und ihre Ghettoisierung beendet werden. Febvre empfahl 1932, die alten überholten Schranken niederzureißen, die babylonischen Anhäufungen von Verurteilten, eingefahrenen Verhaltensweisen, irrigen Auffassungen und falsch Verstandenem abzuwerfen. Darüber hinaus wollten beide zwei Forschungsinteressen verstärken: die Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Dieser Ansatz wurde dann durch neue Fragestellungen und Methoden, z.B. im Hinblick auf die Demokratie, die Religionsgeschichte und die Sozialgeschichte, zu einer Historischen Anthropologie erweitert. 81
10. Neuorientierung der Historiographie
Dabei handelte es sich um eine Neuorientierung und um einen Perspektivenwechsel in der Geschichtsschreibung. Die fruchtbarste neue Perspektive war der Aspekt der „longue durée“, worunter man die Vorstellung verstand, dass die Triebkräfte der Geschichte in langen Zeitabläufen wirken und sich nur in ihnen erfassen lassen. Diese Theorie der langen Zeitabläufe hat auch die Annäherung zwischen der Historik und der Ethnologie oder Anthropologie gefördert, die allerdings nicht spannungsfrei verlief. Febvre und Bloch, die sich besonders mit der Kollektivpsychologie und den Wechselfällen des Geistes in der Geschichte auseinandersetzten, haben so den Weg zur Mentalitätengeschichte bereitet. Seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts rief das Thema der Mentalitäten eine Umwälzung der Historiographie hervor. An die Stelle des privilegierten „Homo politicus“ trat der „Homo humanus“. Geschichte wurde auf diese Weise allmählich, insbesondere in der französischen Geschichtsschreibung, zu einer Historischen Anthropologie. Ihr Bestreben war nicht mehr, das Handeln des irgendwie als gegebenen oder fertigen Menschen zu erklären, sondern den Prozess der Menschwerdung darzustellen, also die Prozesse zu untersuchen, durch die Menschen zu dem geworden sind, was sie jeweils waren. Damit verband sich die wichtige Frage, welchen Anteil der Mensch als denkendes, fühlendes, wünschendes Wesen an diesen Prozessen hatte. Es geht hier also um historische Subjektivität, um vergangenes Seelenleben, um vergangene Gefühle und Sensibilitäten.
Heute steht die Mentalitätengeschichte, wie bereits erwähnt, im Zentrum der Historischen Anthropologie. Ihr Spektrum ist groß und reicht von klassischen Zivilisationsgeschichten bis zu den Werken der „Intellectual History“, von Untersuchungen zur Mentalität verschiedenster sozialer Gruppierungen bis zu historisch ästhetischen Schriften, die sich auf das spezifische Lebensgefühl einer Zeit konzipieren. Dazu gehören vor allem Arbeiten zur Volkskultur, Volksfrömmigkeit und zur Sozialgeschichte der Ideen. 82 Mentalitätengeschichte ist offenbar thematisch im Schnittpunkt zwischen kognitiven und ethischen Bestimmungen, zwischen bewussten Vorstellungen und praktischen Verhaltensweisen angesiedelt. Sie umfasst einen sehr weiten Bereich, der von den zu einer bestimmten Sachkultur gehörigen Praktiken und Formen des Umgangswissens und den kategorialen Formen des Denkens bis zu den kollektiven Affekten und Sensibilitäten reicht. Daher sind Mentalitäten nicht nur Vorstellungen, Einstellungen und Regeln, sondern auch gefühlsmäßig getönte Orientierungen. Mentalitäten sind die Matrices, die das Gefühl erst in seine erkennbaren und gleichzeitig benennbaren Bahnen lenken und kognitive, ethische und affektive Dispositionen umschreiben. 83 Mentalitäten liegen wahrscheinlich nicht im Bereich der Ideen und des Ideologischen, weil Ideen eines Menschen austauschbar und beliebig sind. Wenn man den Menschen genauer kennen und verstehen will, muss man in die Schicht der Glaubensgewohnheiten vorstoßen, also in den Bereich seiner profunden Selbstverständlichkeiten, die er selten bewusst denkt, aber stets empfindet und lebt. Mentalitäten materialisieren sich daher in den von der Geschichtswissenschaft früher weitgehend ausgeklammerten Bereichen des Denkens, Fühlens und Handelns.
Читать дальше