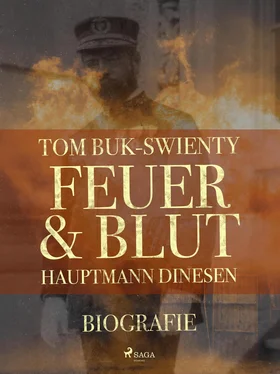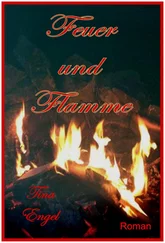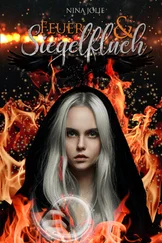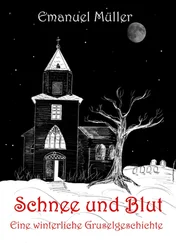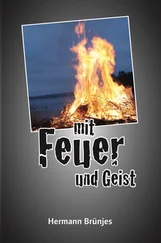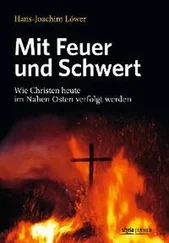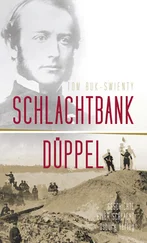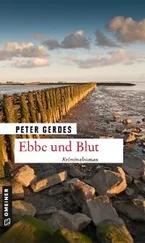Es waren durchgreifende gesellschaftliche Umwälzungen, die den Preissturz und den wirtschaftlichen Niedergang von Katholm ausgelöst hatten. Durch die Landwirtschaftsreformen Ende des 18. Jahrhunderts sollte der Frondienst langsam abgeschafft werden, aber dieser Prozess kam aufgrund der internationalen Agrarkrise nach den Napoleonischen Kriegen 1804–1815 lange Zeit nicht richtig in Schwung. Für viele dänische Bauern war Fronarbeit bis weit ins 19. Jahrhundert Realität. Sie konnten es sich nicht leisten sich freizukaufen, und der Gutsbesitzer konnte es sich nicht leisten, den Grund und Boden zu günstigen Bedingungen zu veräußern. Überall in Europa, auch in Dänemark, mussten viele der in früheren Zeiten grundsoliden Güter zwangsversteigert werden.
Im Jahr 1813 wurde Katholm von einem Kaufmann aus der Gegend namens Herman Leopold Reiningshaus erworben, aber es gelang ihm nie, einen Kaufvertrag für das Grundstück zu bekommen, denn er war nicht einmal in der Lage, die Steuern für das Gut zu bezahlen. So ging das Gut in den Besitz des Staates über. 1818 kauften zwei Bürgerliche, die Schwäger Niels Jørgensen und Jacob Bergh Secher, Katholm. Fähige Männer, die beide, so wird in einer zeitgenössischen Darstellung hervorgehoben, Studenten waren. Sie machten sich mit Feuereifer an die Sache. Die Schwäger brachten die Bauern dazu, die zahlreichen versumpften Teiche, versandeten Heideflächen und mageren Wiesen in der Umgebung des Gutes urbar zu machen. Aber die Schwäger schwangen nicht nur die Peitsche, sie forderten von ihren Zinsbauern auch hohe Pachtzinsen, die sogenannte Landgilde.
Aus einem zeitgenössischen Bericht des Amtskreises geht hervor, dass »insbesondere auf Katholm Gods der Frondienst äußerst bedrückend ist ... die Bauern sind verarmt und in Mutlosigkeit verfallen, sie vermögen kaum, sich aus der Machtlosigkeit zu erheben, in die sie herabgesunken sind«. Nicht lange, und die Gläubiger klopften ans Tor. Die beiden Schwäger waren hoch verschuldet und konnten ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Katholm war erneut zu einem Konkursobjekt geworden und kam wieder in Besitz des Staates, der darauf wartete, dass eines Tages der richtige Käufer auftauchen würde. Und dieser kam in Gestalt von A.W. Dinesen.
Aber dennoch, 100 200 Reichstaler waren ein kleines Vermögen, und der Kauf eines Konkursobjekts ein etwas riskanter Einsatz, wenn man die immer noch erbärmliche landwirtschaftliche Konjunktur in Betracht zog. A.W. Dinesen, der den größten Teil des Geldes, das er nach dem Tod seines Vaters Jens Kraft Dinesen 1827 geerbt hatte, auf seinen vielen Reisen ausgegeben hatte, musste sich für den Kauf von Katholm obendrein bis über beide Ohren verschulden.
Wenn er sich Hoffnungen machen sollte, dem Landgut wieder auf die Beine helfen zu können, musste er sich ganz und gar darauf konzentrieren. Deshalb nahm er nach dem Kauf des Anwesens seinen Abschied vom Heer. So gesehen war A.W. Dinesen ein Glücksritter, und es erwartete ihn ein Ritt, den er gerade aufgrund der geringen Aussicht auf Erfolg in vollen Zügen und aus seinem ganzen Wesen heraus genießen sollte.
Auch wenn A.W. Dinesen nicht mehr auf der Soldliste des dänischen Militärs stand, sondern, wie man es nannte, à la suite gestellt worden war, schien dennoch mit dem Einzug des neuen, hyperaktiven, jungen Gutsbesitzers auf Katholm Gods tatsächlich so etwas wie ein General in die Gegend gekommen zu sein.
Und er kam nicht allein.
Der militärische Berater König Frederiks VI. während der Napoleonischen Kriege, der unverheiratete General und Gutsbesitzer Wolfgang von Haffner aus Egholm war einer der wohlhabendsten Männer des Reiches. Im Alter von einundvierzig Jahren schwängerte er die zwanzig Jahre jüngere Anne Margrethe Kaasbøl, Tochter des trunksüchtigen Sohnes eines Weinhändlers.
Als Fünfzehnjährige hatte die verarmte Anne Margrethe Kaasbøl durch die Hilfe guter Menschen Aufnahme in einem Pfarrhaus in Rønnebæk in der Nähe von Næstved gefunden. Die Frau des Pastors, sie hieß Wilhelmine Magdalena, war eine geborene »von Haffner« und die Schwester des Generals. Bei einem seiner Besuche bei seiner Schwester warf der mächtige General ein Auge auf die junge Anne Margrethe Kaasbøl.
Ihr erstes Kind, das nach dem Vater auf den Namen Wolfgang getauft wurde, wurde 1811 außerehelich geboren. Der Standesunterschied zwischen Anne Margrethe und dem General war so groß, dass eine Heirat der beiden undenkbar schien. Aber Anne Margrethe, eine charismatische Frau mit einem ansteckenden Lächeln, lebhaften Augen und einer auffallenden Willensstärke, bezauberte den General dermaßen, dass er sich zu dem Kind bekannte und sie als Geliebte behielt.
Was natürlich nicht ohne Folgen blieb. Im Jahr 1812 gebar Anne Margrethe einen Sohn, Wentzel, 1815 kam Vibeke Ragnhild zur Welt, im Jahr danach Waldemar und zwei Jahre später Dagmar Alvilde. 1821 gebar Anne Margrethe eine weitere Tochter, Thyra Valborg. Diese jüngste Tochter wurde nicht außerehelich geboren, denn zwei Jahre zuvor hatte der König allergnädigst dem alleruntertänigsten Ersuchen des Generals stattgegeben, dass er trotz seines standesmäßigen Fauxpas die Mutter seiner Kinder heiraten konnte.
Die beiden jüngsten Töchter des Paares, Alvilde und ihre kleinere Schwester Thyra, erregten aufgrund ihrer Schönheit in den Kopenhagener Palais auf den Bällen der Wintersaison großes Aufsehen. Später, als sie in ihren mittleren Jahren waren, faszinierten die beiden Schwestern ihre Umgebung mit ihrem schönen, schwarzen Haar; in ihrer Jugend allerdings hatten sie ein markant unterschiedliches Äußeres: Alvilde hatte Locken und war aschblond, Thyra hatte schon in ihren Jugendjahren glatte, dicke und rabenschwarze Haare.
Selbstverständlich bezauberten die beiden Schwestern auch jedermann, weil sie aufgrund des Reichtums ihres Vaters für jeden ehrgeizigen Freier als eine der besten Partien im Reich galten. Welchen sie letztlich wählen würden, war natürlich eines der großen Gesprächsthemen, wenn die Herrschaften der Stadt in den Ecken tuschelten und wisperten. Der Vater der Mädchen und Mann von Anne Margrethe, der große General Wolfgang von Haffner, starb bereits 1829, allerdings hatte sein ältester Sohn bereits sachkundig die Bewirtschaftung der Güter und Besitzungen des Vaters übernommen, zu denen neben dem Landgut Egholm Gods in Mittelseeland auch das Gut Holmegaard und ein kleineres Palais in Kopenhagen zählten.
Die Schwestern Alvilde und Thyra wählten außergewöhnliche Ehemänner. Thyra heiratete ganz standesgemäß den mit Abstand höchstrangigen Adligen, den etwas korpulenten, gutmütigen Lehnsgrafen Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs til Frijsenborg, Dänemarks größten Grundbesitzer, allgemein bekannt als Graf C.E. Frijs. Damit wurde sie Lehnsgräfin. Über den Grafen und die Gräfin werden wir in diesem Buch später noch einiges mehr hören.
Alvilde dagegen hielt sich an Romantik und Abenteuer. Sie ließ sich von einem jungen, selbstsicheren, männlichen und etwas arroganten Artillerieoffizier und Charmeur betören, der mit exotischen Berichten von seinen arabischen Feldzügen in Nordafrika aufwarten konnte. Außerdem war er soeben Gutsbesitzer geworden und überzeugt, dass er eines Tages ein vermögender Mann sein würde.
A.W. Dinesen kaufte sich sozusagen gleichzeitig sein kleines Schloss und verliebte sich in die zweiundzwanzigährige Dagmar Alvilde von Haffner. Bis zu diesem Zeitpunkt war er ein rastloser Junggeselle auf ewiger Suche gewesen, und das nicht nur nach militärischen Erfahrungen, Abenteuern und Krieg. Genauso intensiv hatte er Jagd auf schöne Frauen gemacht, allerdings nie mit ernsthaften Absichten. Die Rolle des Verführers betrachtete er als natürliches Element seiner Männlichkeit.
Aber er spürte, dass der Kauf von Katholm eine Verpflichtung bedeutete und sein Leben belasten würde, daher beschloss A.W. Dinesen, sein hektisches Leben als Schürzenjäger aufzugeben. Zu einem Landgut gehörte eine Familie, und er war entschlossen, so schnell wie möglich eine Familie zu gründen.
Читать дальше