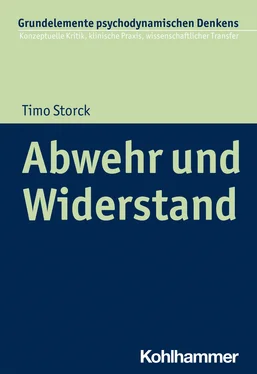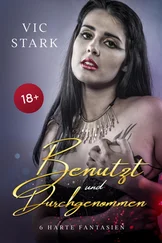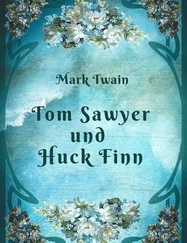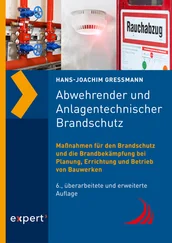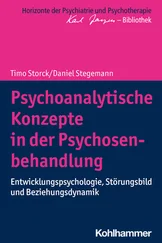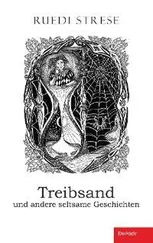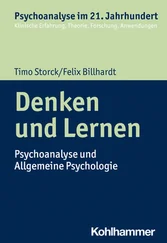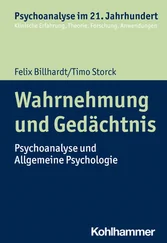Die Schwierigkeiten, ein einmal »gefundenes« Symptom aufzugeben, haben nun nicht nur damit zu tun, dass dann Unlust mobilisiert würde, sondern auch aufgrund von etwas, das Freud (1916/17, S. 360) als eine »Zähigkeit, mit welcher die Libido an bestimmten Richtungen und Objekten haftet, sozusagen die Klebrigkeit der Libido«, bezeichnet, eine »Zähigkeit oder Klebrigkeit der Libido, die einmal von ihr besetzte Objekte nicht gerne verläßt« (a. a. O., S. 473) oder »eine Schwerbeweglichkeit der Libido, die ihre Fixierungen nicht verlassen will« (Freud, 1940a, S. 108).
Widerstand regt sich also, »[w]enn wir es unternehmen, einen Kranken herzustellen, von seinen Leidenssymptomen zu befreien« (Freud, 1916/17, S. 296), und setze sich über die Dauer der Behandlung fort. Er sei »sehr mannigfaltig, höchst raffiniert, oft schwer zu erkennen, wechselt proteusartig die Form seiner Erscheinung« (a. a. O., S. 297) und richte sich besonders gegen die »technische[.] Grundregel« der freien Assoziation, diese werde »zum Angriffspunkt des Widerstandes«, insofern sie ja gerade auf die Spur unbewusster Verbindungen führen soll: »Bald behauptet er, es fiele ihm nichts ein, bald, es dränge sich ihm so vieles auf, daß er nichts zu erfassen vermöge« (a. a. O.). Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Widerstand gegen die Übertragung, aber auch der Übertragung als Widerstand zu (s. Kap. 4.4.1).
Das Auftreten von Widerständen ist keine »unvorhergesehene Gefährdung der analytischen Beeinflussung«, sondern sie müssen zum Vorschein kommen, denn die »Überwindung der Widerstände [ist] die wesentliche Leistung der Analyse« (Freud, 1916/17, S. 301). Dabei wechselt der Widerstand »im Laufe einer Behandlung beständig seine Intensität; er steigt immer an, wenn man sich einem neuen Thema nähert, ist am stärksten auf der Höhe der Bearbeitung desselben und sinkt mit der Erledigung des Themas wieder zusammen.« (a. a. O., S. 302) Freud meint, die Kritik des Kranken bzw. dessen Äußerungen über den fraglichen Wert der Arbeit, insbesondere »kritische Einwendungen« gegen die Grundregel (Freud, 1926d, S. 66), sei »keine selbständige, als solche zu respektierende Funktion, sie ist der Handlanger seiner affektiven Einstellungen und wird von seinem Widerstand dirigiert« (Freud 1916/17, S. 303).
2.3.3 Widerstandsphänomene
Greenson (1967, S. 72 ff.) listet einige typische Manifestationen des Widerstands auf, wobei erneut deutlich wird, dass es eine Frage von Kontext und Funktion ist, ob ein bestimmtes Verhalten als Widerstandsphänomen aufgefasst werden kann:
• Der Patient schweigt
– Patient ist »bewußt oder unbewußt abgeneigt […], dem Analytiker seine Gedanken oder Gefühle mitzuteilen«
– könne auch »Wiederholung eines früheren Ereignisses sein, bei dem Schweigen eine Rolle gespielt hat« (a. a. O., S. 73)
• Der Patient »ist nicht zum Reden aufgelegt«
• Der Patient meint, er habe nichts zu sagen
• Der Patient zeigt keine oder unangemessene Affekte
• Die Körperhaltung des Patienten
– starr, zusammengerollt, sich windend, über die Stunde lang unverändert
• Eine Fixierung in der Zeit
– Patient spricht nur über Vergangenheit oder nur über Gegenwart und beides dient jeweils der Vermeidung des anderen
– Einerseits eine Art von ›Flucht ins Biografische‹ und andererseits ein Beharren auf der Ungeschichtlichkeit aktuellen Erlebens
• Berichte über triviale oder äußere Ereignisse
– »Wenn das Gerede über Unwichtiges dem Patienten nicht selber als etwas Seltsames auffällt, haben wir es mit einem Weglaufen zu tun.« (a. a. O., S. 75)
– »Wenn die äußere Situation nicht zu einer persönlichen, inneren Situation führt« (a. a. O., S. 76)
– Es entsteht hier ein Problem durch die Grundregel der freien Assoziation, die prinzipiell dazu auffordert, sich nicht an vermeintlicher Wichtigkeit oder geordneten Zusammenhängen zu orientieren; allerdings muss gesagt werden, dass Analysanden sich in eine (pseudo-)freie Assoziation flüchten können, die nicht in die Einsicht in unerkannte Zusammenhänge im Psychischen führt, sondern diese verschleiert.
• Das Vermeiden bestimmter Themen
– Peinliches wird vermieden durch die Wahl abgeschwächter Ausdrücke
– »Sexuelle oder feindselige Phantasien in bezug auf die Person des Analytikers gehören auch zu den am Anfang der Analyse höchst eigensinnig umgangenen Themen.« (a. a. O., S. 76)
• Starrheiten
– »Alle sich wiederholenden Routinehandlungen, die der Patient in den Analysestunden unverändert vollzieht« (a. a. O., S. 77)
• Die Verwendung von Klischees, Fachwörtern oder »steriler Sprache«
• Zuspätkommen, Versäumen von Stunden, vergessen zu bezahlen
• Das Ausbleiben von Träumen
– als »ein Anzeichen für den Kampf des Patienten gegen die Offenlegung des Unbewußten und besonders seines Trieblebens vor dem Analytiker« (a. a. O., S. 79)
• Der Patient langweilt sich
• Der Patient hat ein Geheimnis
• Agieren (s. Kap. 2.4)
• Häufige »fröhliche« Stunden
– »Im großen ganzen [sic!] ist die analytische Arbeit ernst« (a. a. O., S. 81)
– Dies ist natürlich nicht misszuverstehen als ein Makel der guten Laune, sondern einzuschätzen als eine positive Stimmung, die demonstrativ schwierige Gefühle und Themen zu verdecken scheint.
• Der Patient ändert sich nicht…
• Ein »stiller Widerstand«
– verstehbar als Ausdruck »subtile[r] Charakterwiderstände« (a. a. O., S. 82) (s. Kap. 3.3)
2.4 Agieren und Enactment
Ein vertiefter Blick ist auf die Figur des Agierens zu richten (vgl. Storck, 2013). Agieren meint zunächst einmal auch in der Psychoanalyse ein Handeln, das hier aber unter Widerstandsaspekten und im Gegensatz zur Vorstellung oder Verbalisierung gebraucht wird. Freud entwickelt das Konzept im Zusammenhang seiner Reflexionen zur Behandlung mit Dora, die die analytische Behandlung abgebrochen hatte. Freud versteht dies als handlungsmäßiger, auf die Übertragung bezogener Ausdruck eines Racheimpulses ihm gegenüber: Sie »rächte […] sich an mir, wie sie sich an Herrn K. [einem Bekannten von Doras Eltern, bzgl. dem Freud von einer enttäuschten Liebe Doras ausging; TS] rächen wollte, und verließ mich, wie sie sich von ihm getäuscht und verlassen glaubte. Sie agierte so ein wesentliches Stück ihrer Erinnerungen und Phantasien, anstatt es in der Kur zu reproduzieren« (Freud, 1905e, S. 283). Freuds Gedanke ist, dass seine Patientin im Rahmen der Behandlung an aktualisierte schwierige Gefühle (und Fantasien) gelangt, diese aber, statt sie in der Analyse zu verstehen und zu bearbeiten, etwa indem sie sie Freud gegenüber verbalisiert, im Abbruch der Behandlung einen Ausdruck finden. Agieren heißt also, Gefühle, Fantasien oder Assoziationen nicht in das Sprechen im Rahmen der analytischen Beziehung und Stunde einzubeziehen, sondern sie in Szene zu setzen, ohne dass es bearbeitet werden kann.
Etwas später benennt Freud noch einen anderen Aspekt des Agierens, in dem es nicht nur darum geht, unter Agieren das zu verstehen, was jemand außerhalb der Behandlungsbeziehung tut und die Bezogenheit auf diese nicht erkennt. Sondern er formuliert, in Analysen »ohne erfreulich glatten Ablauf« könne man sagen, »der Analysierte erinnere überhaupt nichts von dem Vergessenen und Verdrängten, sondern er agiere es. Er reproduziert es nicht als Erinnerung, sondern als Tat, er wiederholt es, ohne natürlich zu wissen, daß er es wiederholt. Zum Beispiel: Der Analysierte erzählt nicht, er erinnere sich, daß er trotzig und ungläubig gegen die Autorität der Eltern gewesen sei, sondern er benimmt sich in solcher Weise gegen den Arzt.« (Freud, 1914g, S. 129) Hier zeigt sich ferner die wichtige Bedeutung des Agierens für Freuds Begriff der Übertragung, denn letztlich betont er hier, das Phänomen, sich der Analytikerin gegenüber auf eine bestimmte Weise zu geben, könne seinen Ursprung in den Beziehungen zu den Eltern haben. Hier ist zumindest angedeutet, dass das Agieren nicht allein Widerstandscharakter hat, sondern auch etwas (nicht Verbalisierbares) erkennbar werden lässt.
Читать дальше