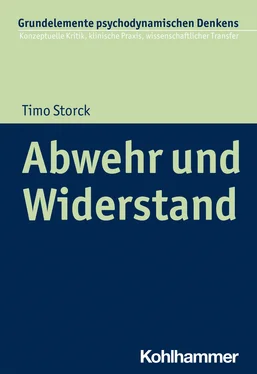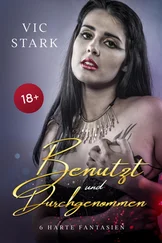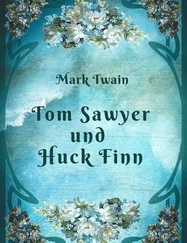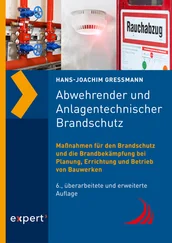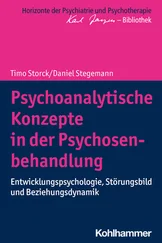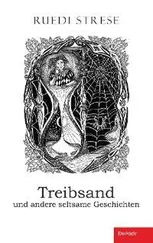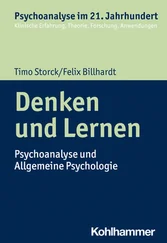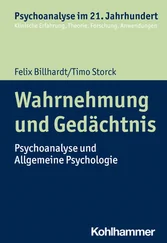Zum Umgang mit dem Agieren ist ferner zu sagen, dass ein Primat der Deutung bei gleichzeitiger Versagung einer andersartigen Beantwortung heute nicht mehr wie früher behandlungstechnisch maßgeblich ist. Fragt also etwa eine Analysandin zu Beginn der Stunde: »Kann ich bitte ein Glas Wasser haben?«, dann wird die Analytikerin vermutlich in der Regel und den meisten Kontexten ein Glas Wasser zur Verfügung stellen. Das ist durchaus ein Enactment. Die Analysandin sagt nicht: »Ich brauche Sie heute als jemanden, der erkennt, wie ausgedürstet ich bin« und die Analytikerin antwortet auch nicht mit: »Heute sind Ihre Versorgungswünsche wieder sichtbar«, sondern es wird wechselseitig eine Handlung eingeleitet und ausgeübt, die aber nichtsdestoweniger auch psychodynamisch und in ihrem Charakter als gemeinsame Inszenierung verstanden werden kann. Maßgeblich ist nicht (mehr), dass nicht agiert werden darf, sondern dass nicht agiert werden sollte, ohne dass dem Agieren bzw. Enactment eine verstehende Reflexion folgt.
Nichtsdestoweniger herrscht nicht überall Einigkeit über die Einschätzung von Enactments, wie die sog. Enactment Controversies (Ivey, 2008) zwischen der Freud-Klein-Richtung und der relationalen Psychoanalyse abbilden, in denen es wesentlich um die Frage geht, ob die Beteiligung der Analytikerin am Enactment unvermeidlich, aber unerwünscht ist, da es auf ihrer Seite ein fehlgeschlagenes Containment und mangelnde Spannungstoleranz anzeigt (also ein Zusammenbrechen ihrer analytischen Funktion), oder ob Enactments die entscheidenden Momente in einer Behandlung und eine notwendige Voraussetzung für Veränderung sind, und ob die Analytikerin darin »mit offenen Karten spielen« (Renik, 1999) sollte.
Mittlerweile wird das Agieren also offener betrachtet als zu Beginn der Konzeptentwicklung, heute steht der kommunikative Aspekt im Zentrum. Dabei wird anerkannt, dass manche Analysandinnen eben nicht immer sagen können, was los ist, sondern stattdessen machen, was los ist. Auch darin sind aktualisierte Beziehungsszenen und Fantasien enthalten. Bereits Lacan (1962/63, S. 159) bezeichnet das Agieren dabei als »wilde Übertragung« und bei Greenson (1967, S. 260) taucht das Agieren als »Griff nach dem Objekt« auf. Der (auch) abgewehrte Objektbezug darin verdeutlicht die Ambivalenz gegenüber Beziehungen. Ich habe daher den Vorschlag gemacht (Storck, 2013), einige Bemerkungen Freuds (1911b, S. 233) umzuwenden, in denen er vom Denken als Probe-Handeln spricht: »Die notwendig gewordene Aufhaltung der motorischen Abfuhr (des Handelns) wurde durch den Denkprozeß besorgt, welcher sich aus dem Vorstellen herausbildete. Das Denken wurde mit Eigenschaften ausgestattet, welche dem seelischen Apparat das Ertragen der erhöhten Reizspannung während des Aufschubs der Abfuhr ermöglichten. Es ist im wesentlichen ein Probehandeln mit Verschiebung kleinerer Besetzungsquantitäten, unter geringer Verausgabung (Abfuhr) derselben.«
Für das Agieren kann demgegenüber von einem »Handeln als Probe-Denken« gesprochen werden. Hier entscheiden die Folgen der motorischen Aktion, der Handlung also, darüber, was gedacht werden kann, d. h. was psychisch tolerabel ist und welches die Folgen des In-Beziehung-Stehens sind. Dabei wird im Agieren etwas ver-handelt, und zwar nicht irgendwas, sondern es geht konkret um eine an die Handlung delegierte Form des Herantastens an die Ambivalenz in Relation zur Analytikerin, weil eine Angst vor innerer Überflutung vorherrscht. Wie Beziehungen sich anfühlen, muss ausprobiert werden.
2.5 Fallbeispiel Herr A., Teil I
Was hat sich nun bisher konzeptuell zur Abwehr gezeigt? Sie dient allgemein der Vermeidung des Erlebens von Unlust (Angst, Scham, Schuldgefühle) und ist eingebettet in die psychoanalytische Theorie unbewusster psychischer Konflikte. Abwehrvorgänge spielen sich an Triebrepräsentanzen (Vorstellungen und Affekte) ab und arbeiten ihrerseits unbewusst, was die Annahme zur Folge hat, dass sie einem unbewussten Anteil des Ichs zuzuordnen sind. Auf diese Weise wird etwas vom bewussten Erleben ferngehalten; aufgrund der Einbettung in Konfliktkonzeption und Triebwünsche resultiert so ein Dynamismus des Psychischen und es kann davon gesprochen werden, dass die Abwehr dynamisch Unbewusstes nach sich zieht. In klassischer Betrachtung tauchen dabei die Verdrängung und ein weiterer Abwehrmechanismus auf, wodurch eine bewusstseinsfähige Ersatz- bzw. Kompromissbildung erzeugt wird. Als Widerstand betrachtet man das Wirken einer Abwehr gegen das Bewusstwerden in analytischen Behandlungen.
Anhand eines Fallbeispiels, das sich in vier Abschnitten in die Überlegungen des vorliegenden Bandes einfädeln wird, kann das Gemeinte verdeutlicht werden. Cripwell (2011) beschreibt darin die Behandlung mit dem Mitte 40-jährigen Herrn A., einem Patienten mit depressiven und zwanghaften Zügen.
Herr A. sucht die Behandlung aufgrund eines Gefühls von Festgefahrensein auf. Er verschwende sein Leben, habe die Überzeugung, eine Person ohne Substanz zu sein, und erlebe oft das Gefühl, zu scheitern. Er ist geplagt von Zweifeln an seinem Leistungsvermögen im Beruf als Geschäftsführer eines kleinen Betriebs. Außerdem zweifelt er daran, ob er seine Freundin liebe, und erlebt dann wiederum Schuldgefühle bezüglich dieses Zweifels. Er gerät also schnell in kreisende, selbstkritische Gedankenkreise. Herr A. schildert seine Überzeugung, er müsse Perfektion erreichen, was ihn dann jedoch dazu bringe, ständige Enttäuschungen zu erleben, weil er seine Ziele nicht erreicht. Es zeigen sich auch Zwangshandlungen im engeren Sinn, so beschreibt er Rituale, z. B. die Küche zu reinigen und aufzuräumen, die in bestimmter Reihenfolge und nach bestimmten Regeln durchgeführt und wiederholt werden müssen, bei Unterbrechung müsse er von vorne beginnen. Er verliert sich über Stunden in Gedanken zu Plänen für die Arbeit und beschreibt das Gefühl von Leere, das ihn überwältigt (Cripwell, 2011, S. 123).
Über seine Biografie berichtet Herr A. eher nichtssagend. Seine Mutter habe hart gearbeitet und an einer Depression gelitten, sie sei auch medikamentös behandelt worden, als er drei Jahre alt gewesen sei. Als die Analytikerin anmerkt, dass ihn das beeinflusst haben könnte, wird das seinerseits abgetan: Es sei ja nur kurz gewesen und nicht bedeutsam. Der Vater sei sportlich, anders als er selbst, es gebe zwischen ihnen wenig Gemeinsamkeiten. Er habe sehr gute schulische Leistungen erbracht und ihn hätten immer Ordnungsrituale beschäftigt. Im Alter von elf Jahren habe er erstmals Zwangsgedanken bezüglich des Tods der Eltern sowie Suizidgedanken gehabt. Er habe das Gefühl, das seien keine Gedanken über ihn gewesen (a. a. O., S. 124).
Die analytische Behandlung beginnt (mit fünf Wochenstunden) und Herrn A. beschäftigt die Frage, ob er eine Analyse überhaupt brauche. Vielleicht sei es ein Fehler. Die Analytikerin fasst das so auf, dass er »sich selbst und mich in einem begrenzten psychischen Raum belassen« müsse (a. a. O., S. 124; Übers TS., auch im Weiteren). Herr A. kommt oft zu den Stunden nach dem Wochenende und berichtet von nichts, das er erlebt habe. Es sei nicht viel passiert, das von Relevanz für die Analyse sei. Wenn die Analytikerin das zu vertiefen versucht (etwa durch die Thematisierung, dass vielleicht ja noch nicht ganz klar sei, was von Relevanz sein könnte), erlebt Herr A. sie als intrusiv und verweigert sich umso mehr dem Erzählen. Cripwell beschreibt, dass er keine Neugier auf ihre Person zeige und erlebt, wie er »darum ringt, seine Gedanken irgendwie zu ordnen« (a. a. O., S. 124).
Seine Arbeit ist für Herrn A. eine konstante Quelle von Angst, oft fällt es ihm schwer, dort rechtzeitig zu gehen, um pünktlich zur Analysestunde zu kommen. Auch wenn er genügend Zeit hat, beginnt er kurz vor dem Ende mit Aufgaben, die noch ganz dringend und unverzüglich erledigt werden müssen: »Nach einer anfänglichen Zeit von Pünktlichkeit, begann er, sich regelmäßig zu verspäten« (a. a. O., S. 124 f.). In seinem Erleben liegen solche Situationen außerhalb seiner Kontrolle. Herr A. ist fasziniert davon, wenn er in aufeinander folgenden Stunden genau dieselbe Zahl von Minuten zu spät ist. Deutungen dazu, die (Nähe zur) Analytikerin auf diese Weise zu kontrollieren, empfindet er als bedeutungslos. Er könne verstehen, dass es feindselig wirken könnte, fühle sich aber nicht so. Anhand dessen lässt sich u. a. gut diskutieren, zu welchem Zeitpunkt eine Deutung gegeben werden sollte und wann sie Widerstand mobilisiert. Hier weist der Analysand zurück, dass es in seinem Zuspätkommen um eine Kontrolle oder gar eine Feindseligkeit gehen könnte. Zunächst einmal ist zu sagen, dass die Deutung ja auch schlicht falsch liegen könnte, noch wichtiger ist aber, dass sie möglicherweise zum falschen, einem zu frühen Zeitpunkt gegeben wird, zu dem also Herr A. den Aspekt der Kontrolle von Nähe in Szene setzen, aber nicht empfinden oder gar verbalisieren kann.
Читать дальше