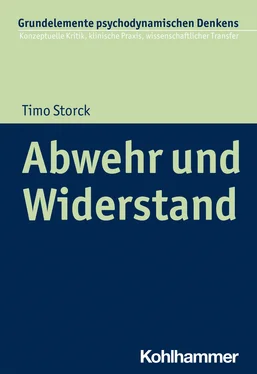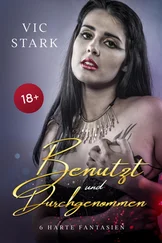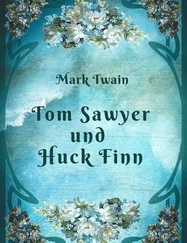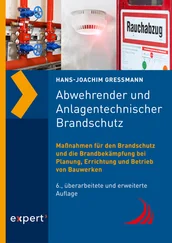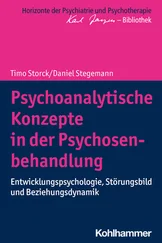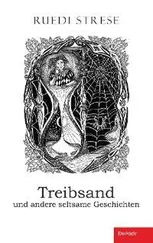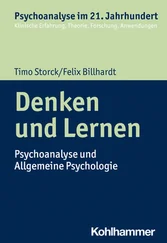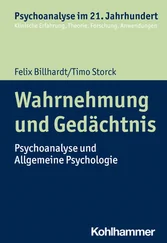Die Analytikerin fühlt sich provoziert und frustriert, der Patient hingegen fühlt sich unverstanden, kritisiert und nicht fähig zur Analyse. Cripwells Annahme ist, dass es sich dabei um die Inszenierung eines »aggressiven und vorwurfsvollen Über-Ich als einer konstanten Quelle innerer Qual für den Patienten« handele, »das nun in mir deponiert war und ich so kritisch wurde« (a. a. O., S. 125). Damit ist gemeint, dass die Analytikerin, motiviert durch die Übertragung des Analysanden und komplementär identifiziert in der Gegenübertragung, Teil der Inszenierung einer strengen Gegenübers gegenüber einem unfähigen Selbst wird. Das ist die angenommene Rolle bzw. die Szene, die sich herstellt und verstanden werden kann.
Herr A. scheint die Analytikerin auch vor seinen Zweifeln daran zu schützen, ob sie seine aggressiven Gefühle und seine Hilflosigkeit »containen« könnte (also, ob sie die schwierigen Gefühle aufnehmen, aushalten und »vorverdauen« kann). Die Analytikerin erlebt in der Gegenübertragung ein Versagensgefühl, allerdings eröffnet dies einen Raum für das weitere Arbeiten, denn so ist sie stärker im Kontakt zu ihm als zuvor. Er kann daraufhin thematisieren, wie er mit niemandem über seine Versagensängste spreche. Die Analytikerin bekommt also recht unmittelbar etwas davon zu spüren (Gefühle von Versagen oder Unzulänglichkeit), was den Analysanden beschäftigt. Statt sich insgesamt mehr anzustrengen, um besser zu sein, erkennt und toleriert sie diese Gefühle, so dass dies sukzessive auch Herrn A. zunächst zugänglich und dann für ihn verarbeitbar wird.
Vor Ferienunterbrechungen beschäftigen Herrn A. oft Sorgen um seine (physische) Gesundheit, Krankheitsängste: »[B]ewusst machten ihm die Ferien nichts aus und er begrüßte sie sogar, aber er übermittelte auch seine primitiven Ängste, ob er überleben würde« (a. a. O., S. 125). Wenn kurzfristig Stunden verschoben werden müssen, fällt es ihm schwer, die Zeiten zu erinnern, und er beschreibt, er fühle sich im Chaos, auch weil er die Fantasie hat, es stimme etwas mit seiner Analytikerin nicht.
Betrachtet man das bisher geschilderte Material unter dem allgemeinen Aspekt der Abwehr, dann zeigen sich die Zwangsgedanken und Zwangshandlungen als Kompromissbildungen zwischen Wunsch (soweit noch einigermaßen unklar; vorstellbar ist, dass es um aggressive Strebungen geht, aber auch global um Nähewünsche) und Abwehr (also Vermeidung der unlustvollen Folgen, hier am ehesten Strafängste und Schuldgefühle oder Näheängste). Die Zwangssymptome könnten dann ein verkleideter Ausdruck der aggressiven Impulse (Todes- und Suizidfantasien) sein oder auch eines Ringens um Selbstkohärenz (Ordnung, Abgrenzung, Vollkommenheit) oder auch schließlich Ausdruck der Kontrolle von Beziehungen (das Objekt soll nicht verloren gehen).
Hinsichtlich des Widerstandskonzepts zeigt sich im Fallbeispiel ein Hindernis gegenüber dem analytischen Arbeiten (Bedeutung, freies Erzählen), der Veränderung und der Übertragungsbeziehung (kein Interesse, keine Bedeutung der Analytikerin – und zugleich die Inszenierung von Beziehungsmustern in Übertragung und Gegenübertragung). Motiviert wird der Widerstand hier durch verschiedene Arten von Ängsten (bzw. drohender Unlust), z. B. angesichts der beschriebenen aggressiven Impulse, Versagensängste, Verlust- oder Abhängigkeitsängste oder der Ängste vor Verlust der Selbstkohärenz. Phänomenal äußert sich der Widerstand z. B. im Zuspätkommen.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.