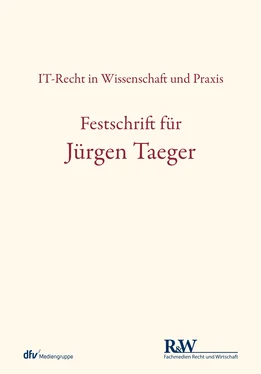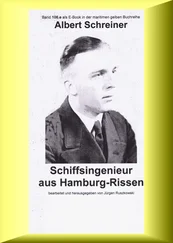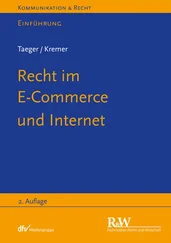Hat der Staat Daten zu verschenken – und darf er das?
Christian Czychowski
Der Jubilar beschäftigt sich mit Themen des Datenschutzes und übergreifenden IT-Themen seit Langem. Seit Kurzem geraten dabei Fragen des reinen Datenrechts, also des Rechtsrahmens für Daten ohne Personenbezug, immer mehr in den Fokus der juristischen Diskussionen.
Daten werden zunehmend Gegenstand von Transaktionen, wie sie überhaupt eine zunehmende Rolle in der Wirtschaft spielen. Das spiegelt sich auch in der stärkeren juristischen Durchdringung der damit einhergehenden Sachverhalte.1 Auch die EU-Kommission beschäftigt das Thema; sie zielt auf einen Binnenmarkt der Daten.2 Dies greift deutlich weiter als der Schutz personenbezogener Daten, für die bekanntlich mittlerweile die Datenschutz-Grundverordnung den Regelungsrahmen vorgibt. Letztere, die personenbezogenen Daten, sollen im vorliegenden Beitrag keine Rolle spielen, auch wenn der Jubilar sich mit ihnen in vielfältiger Weise auseinandergesetzt hat. Der vorliegende Beitrag untersucht nur nicht-personenbezogene Daten und deren rechtlichen Rahmen bei Transaktionen des Staates am Beispiel eines Landes, hier: Bayern.
Die politische Zielvorgabe ist nicht zuletzt seit der Public Sector RL und dem Open Data Gesetz auf nationaler Ebene klar: Informationen und Daten der öffentlichen Hand sollen möglichst unbürokratisch und mit möglichst geringen Kosten der Öffentlichkeit bereitgestellt werden (vgl. Erwägungsgrund 23 und 14 der RL).
In Deutschland wird die Richtlinie durch das Gesetz über die Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen umgesetzt. § 2a IWG bestimmt, dass Informationen, die in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen, weiterverwendet werden dürfen. § 5 IWG legt fest, dass Entgelte für die Weiterverwendung nur auf die Kosten beschränkt sind, die durch die Reproduktion, Bereitstellung und Weiterverwendung verursacht werden.
Die Diskussion um die Rechtsqualität von Daten und darum, ob für Daten ein eigentumsähnliches Recht eingeführt werden soll, dauert schon einige Zeit; es zeichnet sich derzeit ab, dass ein eigenes eigentumsähnliches Recht wohl eher nicht geschaffen wird.3 Dennoch bleibt die Frage, welche Rechtsqualität Daten haben, virulent.4 Denn für die Ausgestaltung der Datenwirtschaft werden Verträge eine wesentliche Rolle spielen. Um deren Gegenstand aber rechtssicher zu bestimmen, bedarf es einer Lösung der Frage, welche Rechtsqualität Daten haben.
I. Datenschätze der öffentlichen Hand
Bund, Länder und Kommunen verfügen über einen großen Schatz an Daten. Man denke nur an Katasterdaten, Daten zu Geistigen Eigentumsrechten (wie Patenten oder Marken), Rechtsprechungsdaten, aber vor allem Verkehrsdaten (Ampeldaten, Verkehrsflussdaten). Weitere Beispiele sind Kennzahlen der Arbeitslosenversicherung, diverse Bevölkerungsstatistiken, Hochfrequenzhandelsdaten im Finanzsektor sowie Daten zur Präzisionslandwirtschaft, die dazu beitragen, den Einsatz von Pestiziden, Nährstoffen und Wasser zu überwachen und zu optimieren. In Betracht kommt auch ein Datensatz verschiedener Wassermesswerte5 oder Feinstaubdaten.6 Gerade der Bereich der Verkehrsdaten dürfte wegen des rasant wachsenden Marktes für digitale Mobilität7 vermutlich einer der ersten Bereiche sein, auf denen auch juristische Fragen zu Transaktionen mit Daten eine Rolle spielen.8
Will die öffentliche Hand nun diese Daten Privaten zur Verfügung stellen oder umgekehrt, begehren Private Zugang zu diesen Daten, muss geklärt werden, ob die öffentliche Hand gezwungen ist, diese Daten Privaten zur Verfügung zu stellen und wenn ja bzw. wenn sie dies (auch ohne Zwang) tut, ob sie besonderen gesetzlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Herausgabe von Daten unterliegt.
Dies soll im Folgenden an einem fiktiven Beispiel aus Bayern untersucht werden. Eine Kommune, nennen wir sie Stoistadt, hat mithilfe ihrer Ampelsysteme und anderen verkehrslenkenden und -leitenden Systemen Daten zu ihren Verkehrsströmen gesammelt und digital gespeichert. Diese Daten sind vollständig anonym, aber von großem Interesse für z.B. private Mobilitätsanbieter, die damit z.B. in Autos ihre Navigationssysteme verbessern können.
II. Muss die Kommune Verkehrsdaten an Private herausgeben?
Rechtsgrundlage für eine Herausgabe der Daten kann nicht das Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) sein, denn aus kompetenziellen Gründen regelt dieses Gesetz nicht den Anspruch auf Informationszugang, sondern setzt diesen voraus. Dies folgt bereits aus § 1 Abs. 2 Nr. 1 IWG, wonach das Gesetz nicht für Informationen gilt, an denen kein oder nur ein eingeschränktes Zugangsrecht besteht. Klarstellend normiert § 1 Abs. 2a IWG, dass ein Anspruch auf Zugang zu Informationen durch das IWG selbst nicht begründet wird.
Beispiele für uneingeschränkte Zugangsrechte finden sich demgegenüber insbesondere in den Informationsfreiheits- bzw. Transparenzgesetzen der Länder, den Umweltinformationsgesetzen, den Geodatenzugangsgesetzen sowie in einschlägigen kommunalen Informationsfreiheitssatzungen.
Auch aus dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes ergeben sich uneingeschränkte Zugangsrechte. Danach hat grundsätzlich jedermann einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen der Bundesbehörden. Antragsberechtigt ist jede natürliche Person und jede juristische Person des Privatrechts.
In Bayern ist es nun so, dass der bayerische Landesgesetzgeber – anders als zahlreiche andere Länder – (bislang) kein eigenständiges Informationsfreiheitsgesetz erlassen hat; er hat vielmehr ein „Allgemeines Auskunftsrecht (zu Art. 86 DSGVO)“ in Art. 39 des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) eingeführt. Nach dessen Abs. 1 Satz 1 hat jeder das Recht auf Auskunft über den Inhalt von Dateien und Akten öffentlicher Stellen, soweit ein berechtigtes, nicht auf eine entgeltliche Weiterverwendung gerichtetes Interesse glaubhaft dargelegt wird und zum einen bei personenbezogenen Daten eine Übermittlung an nicht öffentliche Stellen zulässig ist und zum anderen Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht beeinträchtigt werden.
Es ist freilich fraglich, ob Private auf Basis dieser Vorschrift einen umfassenden Zugang zu den in Rede stehenden Verkehrsdaten geltend machen können.
Der von dem IWG vorausgesetzte Zugangsanspruch könnte sich aus der Informationsfreiheitssatzung, die die Gemeinde Stoistadt sich gegeben hat, ergeben. Während sich die in Rede stehenden Verkehrsdaten unter den legaldefinierten Informationsbegriff fassen lassen dürften („Informationen im Sinne dieser Satzung sind alle bei der Gemeinde Stoistadt auf Informationsträgern vorhandenen Informationen in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises“), bestehen erhebliche Zweifel, ob der private Mobilitätsanbieter als eine juristische Person des Privatrechts Anspruchsberechtigter nach § 3 der Informationsfreiheitssatzung sein kann. Anspruchsberechtigt ist hiernach jeder „Einwohner und jeder Einwohner der Gemeinde Stoistadt im Sinne des Art. 15 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern“. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Gemeindeordnung bezieht sich auf „Gemeindeangehörige“ – Gemeindeangehörige sind alle Gemeindeeinwohner. Bezugspunkt der gemeindlichen Informationsfreiheitssatzung (wie vieler vergleichbarer Satzungen in Deutschland) sind damit offenbar ausschließlich natürliche Personen, sodass diese kommunalrechtliche Regelung ebenfalls keinen Zugangsanspruch für den privaten Mobilitätsanbieter darstellt, der Grundlage für die Anwendbarkeit des IWG sein könnte.
Daneben erfasst das IWG aber auch Informationen, die die öffentliche Hand von sich aus bekannt gemacht hat. Dies hat das BVerwG in seiner wichtigsten Entscheidung zum IWG herausgearbeitet.9 Nach Einschätzung des BVerwG würden dem Anwendungsbereich des IWG zu enge Grenzen gesetzt, wollte man einen Anspruch auf voraussetzungslosen Zugang zu den begehrten Informationen im Sinne eines subjektiven öffentlichen Rechts voraussetzen. Vielmehr sei es so, dass nach dem Sinn des IWG diesen nicht nur Informationen unterfallen, zu denen ein uneingeschränktes Zugangsrecht bestehe, sondern auch solche, die aus anderen Gründen zugänglich seien, d.h. insbesondere Informationen, die öffentliche Stellen aufgrund spezialgesetzlicher, rein objektiv-rechtlich bindender Pflichten veröffentlichen müssen und solche Informationen, die öffentliche Stellen freiwillig veröffentlichten.
Читать дальше