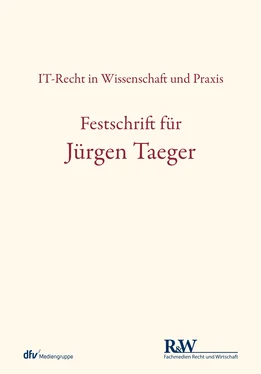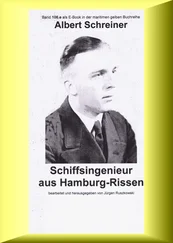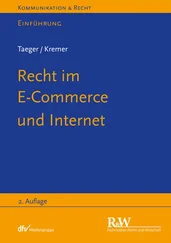Hieraus folgt, dass das IWG auch dann Anwendung findet, wenn die Kommune die fraglichen Verkehrsdaten bereits veröffentlicht hat bzw. diese veröffentlicht, indem sie sie etwa dem privaten Mobilitätsanbieter zur Verfügung stellt.
III. Darf die Kommune Verkehrsdaten an Private herausgeben?
Grundlage für kommunales Handeln sind in ganz Deutschland Gemeindeordnungen. Diese enthalten spezielle Regelungen zur Herausgabe von Vermögensgegenständen.
Art. 75 der Bayerischen Gemeindeordnung lautet:
„(1) Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht braucht, veräußern. Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden.
(2) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstands gilt Absatz 1 entsprechend. Ausnahmen sind insbesondere zulässig bei der Vermietung kommunaler Gebäude zur Sicherung preiswerten Wohnens und zur Sicherung der Existenz kleiner und ertragsschwacher Gewerbebetriebe.
(3) Die Verschenkung und die unentgeltliche Überlassung von Gemeindevermögen sind unzulässig (Art. 12 Abs. 2 Satz 2 der Verfassung). Die Veräußerung oder Überlassung von Gemeindevermögen in Erfüllung von Gemeindeaufgaben oder herkömmlicher Anstandspflichten fällt nicht unter dieses Verbot.“
Soweit man argumentieren wollte, dass die Überlassung von Verkehrsdaten keine „Veräußerung“ im Sinne der genannten Regelung darstellt (da es bislang kein Eigentumsrecht an solchen Daten gibt, wie oben dargestellt), bleibt Art. 75 Abs. 2 GO Bayern zu beachten, wonach auch für die „Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstands“ die Regelungen des Absatzes 1 entsprechend gelten. Möglicherweise lässt sich die (kostenfreie, dazu sogleich mehr) Überlassung der Daten mit Abs. 3 Satz 2 der Vorschrift rechtfertigen – „in Erfüllung von Gemeindeaufgaben“.
Art. 75 der GO Bayern ist eine Ausprägung des staatsrechtlichen Verbots der Schenkung von Staats wegen, deren Legitimität anderen Grundsätzen unterliegt als die Schenkung zwischen Privaten. Eine Schenkung durch den Staat ist dann legitim, wenn ihr ein Vorteil für das Wohl der Allgemeinheit gegenübersteht. Dazu lesenswert Isensee :10
„Das Schenkungsverbot greift nicht schon dann ein, wenn ein Bedachter auf Kosten der Staatskasse bereichert wird, wie es zivil- oder schenkungssteuerrechtlichen Kriterien entspräche – dann wäre jede Subvention, jede Leistung der Sozialhilfe oder der Entwicklungshilfe eine Schenkung. Vielmehr kommt es erst dann zum Zuge, wenn eine staatliche Zuwendung oder eine Verfügung über staatliches Gut nicht eine gemeindienliche, öffentliche Aufgabe erfüllt, wie sie in den Gesetzen vorgezeichnet wird. Wird die Zuwendung nicht gerechtfertigt, so geht sie für das Gemeinwohl verloren und wird „verschenkt“. Im finanzrechtlichen Sinn kann man von Geschenken – genauer: von illegitimen Geschenken – sprechen, wenn eine Ausgabe oder eine Verfügung über einen Vermögensgegenstand nicht durch einen Vorteil für das Wohl der Allgemeinheit aufgewogen wird, wenn also finanzielle Ressourcen fehlgeleitet werden. Eine finanzielle Vergünstigung ist nur legitim, wenn sie der Prüfung am Gleichheitssatz standhält.
Der gemeindienliche Zweck der Ausgabe bildet nicht nur den Grund ihrer Legitimation, sondern auch das Maß.Die Einbuße muß zwecktauglich, erforderlich und angemessen sein, wie es das Haushaltsrecht vorgibt. Die Gebote haushälterischer Rationalität, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, verwirklichen das Schenkungsverbot, wie es dem Gebot des treuhänderischen Umgangs mit den staatlichen Ressourcen entspricht.“ [Hervorhebungen durch den Verfasser.]
Stellt man in Rechnung, dass mit dem IWG eine Rechtsgrundlage für die „Weiterverwendung von bei öffentlichen Stellen vorhandenen Informationen, insbesondere zur Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen der digitalen Wirtschaft“ (§ 1 Abs. 1 IWG) geschaffen wurde, lässt sich erst einmal sehr gut hören, dass die Überlassung der Verkehrsdaten an den privaten Mobilitätsanbieter, der mit diesen Daten Produkte entwickeln will, die zumindest mittelbar auch dem Wohl der Allgemeinheit dienen, prinzipiell zulässig sein muss. Gegebenenfalls ist ein Korrektiv über einheitliche Nutzungsbedingungen (dazu sogleich mehr) zu etablieren.
IV. Wie ist die Datenweitergabe vertragsrechtlich auszugestalten?
Das IWG macht klare Vorgaben für die Ausgestaltung des Anspruches.
Die betroffene Stelle kann für die Weiterverwendung zwar Nutzungsbestimmungen vorsehen. Diese aber müssen verhältnismäßig sein, dürfen nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung führen und Möglichkeiten der Weiterverwendung nicht unnötig einschränken. Insbesondere ist die Gleichbehandlung der Nutzer zu gewährleisten (§ 4 Abs. 1 IWG).
Der Gleichbehandlungsgrundsatz wirkt sich insbesondere auf die Entgeltberechnung aus. § 5 Abs. 1 IWG beschränkt die Entgelte für die Weiterverwendung von Informationen ohnehin auf die Kosten, die durch die Reproduktion, Bereitstellung und Weiterverbreitung verursacht werden. Damit werden die sogenannten Grenzkosten als regelmäßige Entgeltobergrenze festgelegt. Gleichzeitig aber ist auch zu beachten, dass bei einmaliger kostenfreier Abgabe man später kaum noch auf eine kostenpflichtige Abgabe, die sich an dieser Entgeltobergrenze orientiert, umschwenken kann, ohne mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz in Konflikt zu geraten.
Der Anspruchsberechtigte hat zudem nicht nur ein Recht auf Weiterverwendung, sondern grundsätzlich auch auf die Übermittlung der Informationen in einem Format, mit dem er selbst etwas anfangen kann. Dies folgt aus § 3 Abs. 2 IWG und der dort festgelegten Verpflichtung zur Bereitstellung in elektronischer Form sowie in einem offenen und maschinenlesbaren Format zusammen mit den zugehörigen Metadaten, soweit möglich und wenn damit für die öffentliche Stelle kein unverhältnismäßiger Aufwand verbunden ist. In der Praxis kann das unter bestimmten Umständen eine erhebliche Mehrbelastung sein, der tatsächliche Aufwand für die öffentliche Stelle muss aber im Einzelfall genau geprüft werden und es kann hier nur um solche Aufwände gehen, die überhaupt eine Weiterverarbeitung bei der empfangenen Stelle ermöglichen; es kann nicht darum gehen, dass die empfangene Stelle gewissermaßen die Formate vorgibt, weil bestimmte Formate vielleicht besser in deren Datenverarbeitung passen, obwohl andere Formate durchaus auch verarbeitungsfähig wären.
Hieraus folgt insbesondere, dass der mit der Bereitstellung der Informationen entsprechend den Vorgaben des § 3 Abs. 2 IWG verbundene Aufwand bei der Entgeltberechnung zwingend einzukalkulieren ist (als Teil der Grenzkosten, die verlangt werden können).
Vergleichbar der Diskussion um Open Source Software und Open Access im wissenschaftlichen Bereich, kann man auch im Bereich der öffentlichen Datenwirtschaft ein Ringen um die Frage beobachten, ob mit öffentlichen Mitteln geschaffene Daten nicht grundsätzlich kostenfrei zur Verfügung gestellt werden müssen. Mit der hier vertretenen Auffassung zur Auslegung des IWG ist diese Diskussion müßig, da nach § 5 Abs. 1 IWG die Entgelte für die Weiterverwendung von Informationen ohnehin auf die Kosten beschränkt sind, die durch die Reproduktion, Bereitstellung und Weiterverbreitung verursacht werden. Damit werden – wie oben dargestellt – die sogenannten Grenzkosten als regelmäßige Entgeltobergrenze festgelegt.
Dennoch bleibt natürlich die Frage, mit welchen Vertragsmodellen Daten der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt werden können. Und da hat sich das Modell des Open Data durchaus bewährt. Open Data bezeichnet Datensammlungen, die unter anderem als Ganzes zu nicht mehr als den Reproduktionskosten für jedermann frei verfügbar sind, weiterverbreitet werden dürfen, Modifikationen und Derivate erlaubt sind, offene und damit nicht-proprietäre Dateiformate verwendet werden, niemand bei der Nutzung diskriminiert wird und keinerlei Einschränkungen für mögliche Einsatzzwecke existieren.11 Unter dem Stichwort Open Government Data öffnet sich die Regierung und Verwaltung gegenüber der Bevölkerung und Wirtschaft. Dies kann vor allem durch die kostenlose Bereitstellung von Daten passieren. Auf dem Portal govdata.de werden beispielsweise Daten der öffentlichen Stellen aus Bund, Ländern und Kommunen der Verwaltung angeboten. Ziel der Webseite ist es, dass Daten aus der Verwaltung besser genutzt und weiter verwendet werden, sodass durch neue Ideen sowie Kombinationen und Analyse neue Erkenntnisse aus den vorhandenen Daten gewonnen und neue Anwendungsfelder erschlossen werden können.12
Читать дальше