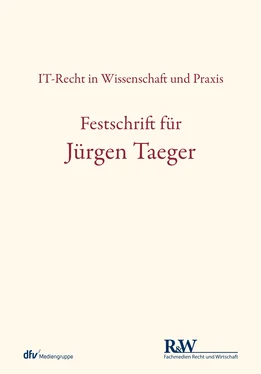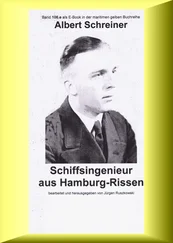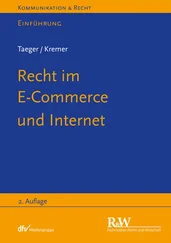Überträgt man die Faustformel für den Besuch und die Nutzung für Webseiten auf die Blockchain, hätte dies zur Folge, dass der bloße Download und die Installation der Blockchain-Node auf dem eigenen Speichermedium noch keinen Rechtsbindungswillen der Beteiligten indizieren würde. Damit wäre vor allem die Frage beantwortet, ob blockchainbasierte Netzwerke von vornherein gesellschaftsrechtliche Zusammenschlüsse darstellen.59 Der fehlende (äußerlich erkennbare) Rechtsbindungswille der Beteiligten ließe jede vertragliche Verbindung entfallen.
Damit würde man jedoch die Anwendungsfelder der Blockchain als solche völlig außer Acht lassen. Der Hauptanwendungsfall der Blockchain sind wohl noch immer Kryptowährungen wie Bitcoin & Co. Der Sinn und Zweck von Kryptowährungen ist gerade das „Bezahlen“ von Waren und Dienstleistungen über die Blockchain. Wer an einer Blockchain für Kryptowährungen teilnimmt, ist sich dessen wohl auch bewusst. Schließlich erfolgt die Teilnahme nicht versehentlich, sondern gerade um den Zweck der bestimmten Blockchain zu nutzen. Damit herrscht bei der Nutzung von Blockchains zumindest ein gewisses Bewusstsein für die Rechtserheblichkeit der Nutzung.
In der rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Webseiten wird der Rechtsbindungswille der Nutzer erst dann angenommen, wenn ein eigener Benutzer mit der Angabe der Klarnamen und Adressen angelegt wird. Überträgt man dies auf die Blockchain, so würde zumindest dann von einem Rechtsbindungswillen der Beteiligten auszugehen sein, wenn diese sich gegenüber einer zentralen Instanz authentifizieren müssten. Damit wäre ein Rechtsbindungswille zumindest bei der Teilnahme an private und permissioned Blockchains erkennbar. Dies setzt jedoch in konsequenter Anwendung der Grundsätze zu Webseiten voraus, dass die Teilnahme nur mit echten persönlichen Daten möglich ist und Phantasienamen, die nur der Eingabemaskensyntax entsprechen, nicht genügen.
b) Rechtsbindungswille bei Blockchain-Transaktionen
Auf Transaktionsebene lässt sich der Rechtsbindungswille der Beteiligten deutlich leichter feststellen. Es muss dabei auf die Person abgestellt werden, welche die konkrete Transaktion versendet hat.60 Löst diese eine Transaktion aus, deren Funktion an sich bereits Rechtserheblichkeit hat, bspw. das Bezahlen mit Kryptowährungen, so kann der objektive Empfänger erkennen, dass die durch das Netzwerk bestimmte Rechtsfolge der Transaktion auch gewollt war.61
Um bei dem Beispiel der Trierer Weinversteigerung zu bleiben: Der Einsatzzweck der Blockchain und der damit zusammenhängende Smart Contract bilden Ort und Regeln der Versteigerung. Wer die Transaktion auslöst, hebt sprichwörtlich die Hand und wirkt für die Anwesenden daher so, als ob er den Inhalt der Transaktion auch gewollt hat. Damit sind die in der Literatur und Rechtsprechung entwickelten Leitsätze und Fallgruppen konsequent für die Blockchain weiterentwickelt worden.
VI. Kritische Betrachtung der Fallgruppen-Methodik
Aus der Perspektive des:der Rechtsanwender:in ist die Verwendung von Fallbeispielen jedoch ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite führen sie zu einer Vereinfachung der Subsumtionsarbeit: Es muss nur noch geprüft werden, ob der zu untersuchende Fall dem Fallbeispiel des Kommentars, Lehrbuchs oder Urteils entspricht. Ist dies der Fall, kann die Subsumtion leicht mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden.
Der umgekehrte Fall zeigt jedoch die Schwächen dieser Vorgehensweise auf. Kein Fall gleicht dem anderen. Wenn ein Sachverhalt nicht einem der Fallbeispiele entspricht, ist der Weg über abstrakte Leitlinien unerlässlich. Erfolgt dann jedoch eine Abstraktion anhand der Fallbeispiele und nicht am Wortlaut des Gesetzes, entfernt man sich weiter von der ratio legis, als es eine herkömmliche Subsumtion mithilfe der Auslegungscanones zur Folge gehabt hätte.
VII. Kritische Betrachtung der Auslegung anhand des objektiven Empfängerhorizonts
Das Problem liegt jedoch nicht in den Tatbeständen der Willenserklärung, die durch Rechtsfortbildung entstanden sind. Vielmehr ist es die Auslegung anhand des objektiven Empfängerhorizonts bzw. der Verkehrssitte, die kritisch betrachtet werden muss. Es ist die Kombination aus wertender, weil „verobjektivierter“62 und vermeintlich empirischer Betrachtung, die Fehler erzeugt. Der objektive Empfängerhorizont ist kein empirisches, sondern ein hypothetisches Konstrukt: Es handelt sich dabei um einen objektiven Beobachter, der gleichsam hinter dem Erklärungsempfänger steht, der alle relevanten Umstände kennt, die für den Empfänger erkennbar waren und den typischen Verständnishorizont derjenigen Verkehrskreise innehat, denen der Empfänger angehört.63
Um sich mit rein empirischen Methoden dem objektiven Empfängerhorizont zu nähern, müsste eine entsprechend große Vergleichsgruppe gebildet werden, die dem Verkehrskreis des Empfängers der Erklärung entspricht. Dieser müsste der Sachverhalt und Gesamtkontext der auslegungsbedürftigen Erklärung so dargelegt werden, dass sie denselben Kenntnisstand wie der Empfänger hat. Dann müsste sie befragt werden, wie die Erklärung zu verstehen sei. Auf suggestive Fragen oder Auslegungsvorschläge müsste dabei verzichtet werden, um das Ergebnis der Befragung nicht zu beeinflussen. Die Ergebnisse der Befragung müssten sodann anhand der Häufigkeit der Nennungen sortiert werden. Die Antwort mit der größten Anzahl würde dann dem Empfängerhorizont entsprechen. Diese Vorgehensweise würde auch dem Verkehrsschutz gerecht. Die Vergleichsgruppe repräsentiert gerade den allgemeinen Rechtsverkehr, der in das Gesagte vertrauen darf. Wenn diese Vergleichsgruppe ein einheitliches oder überwiegendes Verständnis des Gesagten hat, dann muss sich der Verkehrsschutz daran orientieren.
Mit dieser Herangehensweise wäre die Aktualität gerichtlicher Entscheidung stets gewährleistet, da immer auf die aktuelle Vergleichsgruppe des Empfängers der Auslegung abgestellt würde. Zudem wäre damit ein Vertrauen in die gerichtlichen Entscheidungen wenigstens zum Teil wiederhergestellt, ohne dass es zu einer Art Volksgerichtsbarkeit durch die Hintertür führen würde. Es soll nicht die richterliche Entscheidung durch empirischen Mehrheitsentscheid abgelöst werden, sondern allein die Auslegung von Willenserklärungen und Verträgen nach § 113 und 157 BGB auf eine empirische Datenbasis gestellt werden. Das Recht täte gut daran, die eigene „Erklärbarkeit“ in den Vordergrund zu rücken, bevor sich mit der „Erklärbarkeit“ von „Künstlicher Intelligenz“64 auseinandergesetzt wird.
VIII. Interdisziplinarität als Schlüssel
Die Erklärbarkeit setzt jedoch voraus, dass die Anwender:innen des Rechts ihrerseits begreifen, worüber sie juristisch entscheiden bzw. was der Gegenstand der juristischen Betrachtung ist. Der interdisziplinäre Austausch ist dafür unerlässlich. Der Jubilar hat auch in dieser Hinsicht wieder Weitsicht bewiesen und das „Interdisziplinäre Zentrum für Recht der Informationsgesellschaft“ (ZRI) an der Universität Oldenburg ins Leben gerufen. Das Ziel des ZRI ist es, den „technischen Fortschritt nicht nur voranzutreiben oder seine Wirkungen analytisch zu beobachten, sondern die Entwicklungsrichtung auch im gesellschaftlichen Interesse zu lenken“.65 Der interdisziplinäre Austausch ist erforderlich, damit getreu dem Motto der 21. Herbstakademie der DSRI, der technologische Wandel begleitet werden kann.
Zum Schluss bleibt nur noch eins, der Dank und die besten Glückwünsche an den Jubilar. Möge er sich noch viele Jahre für die Interdisziplinarität der Rechtswissenschaft einsetzen können und dabei stets noch genug Zeit für Freunde, Familie und den SC Freiburg haben!
Читать дальше