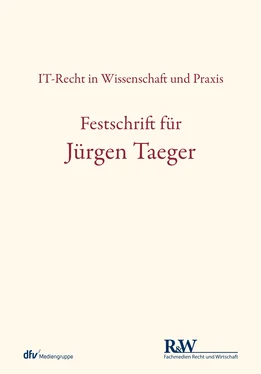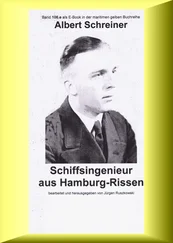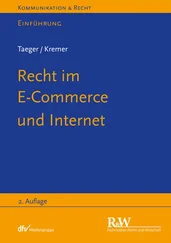Festschrift für Jürgen Taeger
Здесь есть возможность читать онлайн «Festschrift für Jürgen Taeger» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Festschrift für Jürgen Taeger
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Festschrift für Jürgen Taeger: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Festschrift für Jürgen Taeger»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Erörtert werden Themen u.a. aus den Bereichen:
– Datenschutzrecht
– Informations- und Medienrecht
– Recht des geistigen Eigentums
– Bürgerliches Recht
– Vertrags- und haftungsrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit Daten
Das breite Themenspektrum spiegelt die Vielfalt der Tätigkeiten und Interessen des Geehrten und vermittelt so das facettenreiche
Bild des wissenschaftlichen Wirkens eines herausragenden deutschen Juristen.
Festschrift für Jürgen Taeger — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Festschrift für Jürgen Taeger», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
e) Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB)
In gleicher Weise ist denkbar, dass die Fortdauer der Einwilligung Geschäftsgrundlage des Vertrages i.S.v. § 313 BGB ist.79 Widerruft der Betroffene sie später, so fällt die Geschäftsgrundlage weg. Wie bei § 314 BGB auch stellt sich im Rahmen des § 313 Abs. 1 BGB die Frage, ob die weitere Fortführung des Vertrags zu unveränderten Bedingungen dem Anbieter zuzumuten ist, was häufig nicht der Fall sein wird. Dann besteht zunächst ein Anspruch auf Vertragsanpassung, etwa in Gestalt der Erhöhung einer vom Nutzer zu erbringenden finanziellen Leistung oder einer Reduktion des Leistungsumfangs des Vertragspartners, wenn infolge der fehlenden Einwilligung des Nutzers etwa geringere Werbeerlöse zur Refinanzierung der Dienstleistung anfallen. Ist eine solche Anpassung einer der Parteien nicht zumutbar, folgt aus § 313 Abs. 3 Satz 1 BGB ein Rücktrittsrecht für punktuelle Austauschbeziehungen bzw. für Dauerschuldverhältnisse ein Kündigungsrecht nach § 313 Abs. 3 Satz 2 BGB.80
f) Widerruf der Einwilligung als auflösende Bedingung (§§ 158ff. BGB)
Ebenso wie die vorherige Einwilligung zur aufschiebenden Bedingung eines Vertragsschlusses gemacht werden kann, kann auch der Widerruf der Einwilligung als auflösende Bedingung vereinbart werden. Diese wirkt im Zweifel ex nunc (§§ 159 Abs. 2, 159 BGB), ebenso wie der Widerruf der Einwilligung, sodass die Gegenleistung erst ab dem Zeitpunkt des Widerrufs nicht mehr geschuldet ist. Freilich ist für eine derartige Bedingung erforderlich, dass sie entweder ausdrücklich vereinbart ist oder zumindest aus dem Parteiwillen eindeutig hervorgeht (§§ 133, 157 BGB). Das wird nur selten der Fall sein.
g) Vertragsklauseln sui generis
Die in der Praxis weitaus häufigste Lösung dürfte in der Vereinbarung spezifischer Vertragsklauseln für den Fall des Widerrufs der Einwilligung liegen, die i.d.R. Rücktritts- oder Kündigungsrechte vorsehen.81 Derartige Klauseln sind grundsätzlich möglich, sofern sie einer AGB-Kontrolle standhalten. In Ermangelung spezifischer Klauselverbote in den §§ 308, 309 BGB richtet sich diese danach, ob die Klausel mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung nicht zu vereinbaren ist (§ 307 Abs. 1, 2 Nr. 1 BGB). Dieses gesetzliche Leitbild ergibt sich aus den vorstehenden denkbaren gesetzlichen Rechtsfolgen für den Widerruf einer Einwilligung und lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass Sanktionen, die dem Kunden Rechte nehmen, die zum Zeitpunkt des Widerrufs bereits als definitiv erworben anzusehen sind, unzulässig sind, weil sie den Kunden von der Ausübung seines Widerrufsrechts abhalten könnten. Demgegenüber begründen Regelungen, die lediglich pro futuro die wirtschaftlichen Konsequenzen des Widerrufs ziehen und insbesondere das vertragliche Äquivalenzverhältnis für die Zukunft daran anpassen, keinen „Nachteil“ i.S.v. Erwägungsgrund 42 Satz 4 DSGVO und sind daher zulässig. Soweit die Klauseln derartige Konsequenzen lediglich festhalten, näher ausformen und präzisieren, sind diese aus AGB-rechtlicher Sicht unbedenklich; insbesondere liegt dann kein Verstoß gegen das Freiwilligkeitserfordernis der Einwilligung vor. Erst wenn die in den AGB vorgesehenen Konsequenzen darüber hinausgehen und etwa Schadensersatzpflichten oder andere überschießende Sanktionen für den Widerruf einer Einwilligung vorsehen, verstoßen diese gegen § 307 Abs. 1, 2 Nr. 1 BGB und sind daher unwirksam.
IV. Ergebnisse
1. Verträge über den Austausch von „Leistung gegen Daten“ sind vielgestaltig und enthalten häufig andere Gegenleistungskomponenten neben der bloßen datenschutzrechtlichen Einwilligung.
2. Die datenschutzrechtliche Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie freiwillig erteilt wird. Dies schließt jede Form des – unmittelbaren oder mittelbaren – rechtlichen Zwangs zur Erteilung einer Einwilligung aus.
3. Die datenschutzrechtliche Einwilligung muss jederzeit widerruflich sein. Das Widerrufsrecht darf dem Betroffenen auch nicht dadurch verleidet werden, dass das Gesetz oder der Vertrag Nachteile an seine Ausübung knüpft. Das schließt insbesondere Schadenersatzsanktionen und im Regelfall auch ein in die Vergangenheit wirkendes Rücktrittsrecht aus.
4. Eine vertragliche „Pflicht“ zur Einwilligung kann weder eine Leistungspflicht noch einen durchsetzbaren Anspruch des Gläubigers begründen, sondern – wie bei einem Realvertrag – lediglich eine Obliegenheit. Denkbar ist auch, die Einwilligung lediglich als aufschiebende Bedingung für den Vertragsschluss auszugestalten.
5. Die Vorschriften über synallagmatische Verträge (§§ 320ff. BGB) sind auf Verträge über „Daten gegen Leistung“ nicht anwendbar. Insbesondere sind sowohl die Einrede des nichterfüllten Vertrags (§ 320 BGB) als auch das Rücktrittsrecht aus § 323 BGB im Hinblick auf eine nicht erteilte oder widerrufene Einwilligung ausgeschlossen.
6. Soweit die Einwilligung eine Voraussetzung für die technische oder rechtliche Möglichkeit der Erbringung der Gegenleistung ist, schließt deren Widerruf den Anspruch auf die Gegenleistung gem. § 275 Abs. 1 BGB aus. Ob der Betroffene daneben noch zur Erbringung einer zusätzlich vereinbarten (insbesondere finanziellen) Gegenleistung verpflichtet bleibt, ist im Einzelfall am Maßstab des § 326 Abs. 2 Satz 1 BGB zu bestimmen.
7. Bereits erbrachte Leistungen können bei Widerruf der Einwilligung in der Regel nicht zurückgefordert werden (Wirkung nur pro futuro). Eine Ausnahme kann insoweit allenfalls § 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BGB bilden, wenn eine einmalige Leistung als Gegenleistung für eine Einwilligung betreffend eines längeren Zeitraums erbracht wurde und die Einwilligung dann vor Ende des Zeitraums widerrufen wird.
8. Im Übrigen sind – je nach dem Einzelfall – andere Auswirkungen des Widerrufs der Einwilligung auf die „Gegenleistung“ denkbar: In vielen Konstellationen wird er einen Grund zur außerordentlichen Kündigung (§ 314 BGB) oder einen Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) darstellen. Möglich ist auch, dass die Parteien den Widerruf als auflösende Bedingung vereinbaren, sodass der Vertrag mit Bedingungseintritt ex nunc wegfällt.
9. Letztendlich obliegt es den Parteien im Rahmen ihrer Vertragsgestaltung, angemessene Konsequenzen für den Widerruf der Einwilligung zu vereinbaren. Leitschnur für eine AGB-rechtliche Kontrolle ist dabei, dass lediglich technisch oder wirtschaftlich notwendige Konsequenzen aus dem Widerruf gezogen und ggfs. die Erbringung der Gegenleistung zu unveränderten Bedingungen für die Zukunft verweigert werden dürfen. Darüber hinaus gehende Sanktionen, etwa Rücktrittsrechte, die für die Vergangenheit wirken, oder Schadensersatzpflichten sind dagegen regelmäßig unzulässig, weil sie den Betroffenen von der freien Ausübung seines Widerrufsrechts abhalten würden.
1Ausgehend von Taeger, Die Volkszählung, 1983, über Taeger, Umweltschutz und Datenschutz, 1991, und Taeger, Grenzüberschreitender Datenverkehr und Datenschutz in Europa, 1995; Taeger, in: Salger, Handbuch der europäischen Rechts- und Wirtschaftspraxis, 1996, S. 1281ff., bis Taeger, Datenschutzrecht, 2014, und aktuell Taeger/Gabel (Hrsg.), DSGVO/BDSG, 3. Aufl. 2019. 2Siehe insbesondere Taeger/Kremer, Recht im E-Commerce und Internet, 2017, sowie Taeger/Rose, Wirtschaftsprivatrecht, 6. Aufl. 2016. 3Siehe etwa Langhanke/Schmidt-Kessel, EuCML 2015, 218ff.; Metzger, AcP 216 (2016), 817ff.; Graf von Westphalen/Wendehorst, BB 2016, 2179ff.; Schmidt-Kessel/Grimm, ZfPW 2017, 84ff.; Specht, JZ 2017, 763ff.; Dix, ZEuP 2017, 1ff.; Langhanke, Daten als Leistung, 2018; Sattler, in: Schmidt-Kessel/Grimm, Telematiktarife & Co. – Versichertendaten als Prämienersatz, 2018, S. 1ff.; Hacker, ZfPW 2019, 148ff.; Specht, OdW 2017, 121ff. 4Richtlinie (EU) 2019/770 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 20.5.2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen, ABl. 2019 Nr. L 136, S. 1; siehe auch Art. 3 Abs. 1a RL 2011/83/EU n.F. 5Hierzu Dix, ZEuP 2017, 1ff. 6Dazu unten II. 2. 7So etwa Schantz, NJW 2016, 1841, 1845; Ernst, in: Paal/Pauly, DS-GVO/BDSG, 2. Aufl. 2018, Art. 4 DSGVO Rn. 73; wohl auch Stemmer, in: BeckOK Datenschutzrecht, 28. Aufl. 2019, Art. 7 DSGVO Rn. 46; a.A. z.B. Klement, in: Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann, Datenschutzrecht, 2019, Art. 7 DSGVO Rn. 63. 8Näher Schantz, in: Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann (Fn. 7), Art. 6 DSGVO Rn. 34f. 9Siehe dazu eingehend Hacker, ZfPW 2019, 148, 151ff.; Schmidt-Kessel/Grimm, ZfPW 2017, 84, 86ff. 10Hacker, ZfPW 2019, 148, 152; siehe aber auch die weniger eindeutigen Ergebnisse der Studie von Marotta/Abhishek/Acquisti, Online Tracking and Publishers’ Revenues: An Empirical Analysis, https://weis2019.econinfosec.org/wp-content/uploads/sites/6/2019/05/WEIS_2019_paper_38.pdf. 11Hacker, ZfPW 2019, 148, 154f.: „Rabattmodelle“; a.A. zu Unrecht Schmidt-Kessel/Grimm, ZfPW 2017, 84, 87, die hier die Datenüberlassung der Zahlung eines Entgelts gleichstellen; dabei wird übersehen, dass die Daten als solche schon wegen des Verbots versicherungsfremder Geschäfte (§ 15 VAG) einen vernachlässigbaren wirtschaftlichen Wert für die Versicherer haben, der über die feinere Risikoeinstufung hinausgeht; siehe zum Ganzen auch Brand, VersR 2019, 725, 727, 733. 12Das übersieht Hacker, ZfPW 2019, 148, 153f., der hier von „vollkommen datenfinanzierten Modellen“ spricht. 13Vgl. BGH, NJW 2018, 3640; BGH, NJW 2020, 64. 14Siehe nur Taeger, BvD-News 1/2019, 32, 32. 15Schmidt-Kessel/Grimm, ZfPW 2017, 84, 89f.; Buchner, DuD 2010, 39, 39; i. Erg. auch Specht, JZ 2017, 763, 768. 16Diese unterliegt allerdings den Regelungen des BGB über Rechtsgeschäfte nur insoweit, als die DSGVO keine Spezialvorschriften enthält, vgl. etwa Art. 8 Abs. 1 Satz 2 DSGVO zu den Altersgrenzen und den gesetzlichen Vertretern als Sonderregelung gegenüber §§ 2, 106, 111 BGB. 17Albers/Veit, in: BeckOK Datenschutzrecht, Stand: 1.5.2018, Art. 6 DSGVO Rn. 19; näher Stemmer, in: BeckOK Datenschutzrecht (Fn. 7), Art. 7 DSGVO Rn. 28ff. 18Graf von Westphalen/Wendehorst, BB 2016, 2179, 2184; Schmidt-Kessel/Grimm, ZfPW 2017, 84, 91f.; Langhanke (Fn. 3), S. 119; a.A. Sattler, in: Schmidt-Kessel/Grimm (Fn. 3), S. 34ff.; offener auch Specht, JZ 2017, 763, 769 Fn. 45; Specht, OdW 2017, 121, 125f.; zum alten BDSG auch Buchner, Informationelle Selbstbestimmung im Privatrecht, 2006, S. 273. 19Metzger, AcP 216 (2016), 817, 825. 20Siehe dazu unten II. 3. 21Siehe zu diesem Problem – allerdings noch zum alten BDSG – auch Buchner (Fn. 18), S. 253ff. 22So offenbar Specht, JZ 2017, 763, 768; allerdings setzen § 138 Abs. 1, 2 BGB zusätzlich ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung voraus (siehe nur Armbrüster, in: Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2018, § 138 Rn. 113ff.), woran es bei den datengetriebenen Geschäftsmodellen jedenfalls zulasten des Kunden in aller Regel fehlen wird. 23Ernst, in: Paal/Pauly (Fn. 7), Art. 4 DSGVO Rn. 69ff.; Klement, in: Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann (Fn. 7), Art. 7 DSGVO Rn. 54. 24Statt aller Stemmer, in: BeckOK Datenschutzrecht (Fn. 7), Art. 7 DSGVO Rn. 24; Heckmann/Paschke, in: Ehmann/Selmayr, DS-GVO, 2. Aufl. 2018, Art. 7 DSGVO Rn. 22. 25So etwa Schantz, NJW 2016, 1841, 1845; Ernst, in: Paal/Pauly (Fn. 7), Art. 4 DSGVO Rn. 73; wohl auch Stemmer, in: BeckOK Datenschutzrecht (Fn. 7), Art. 7 DSGVO Rn. 46; a.A. z.B. Klement, in: Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann (Fn. 7), Art. 7 DSGVO Rn. 63. 26Hacker, ZfPW 2019, 148, 156f.: „Data on top-Modell“. 27So etwa Ernst, in: Paal/Pauly (Fn. 7), Art. 7 DSGVO Rn. 73; Buchner/Kühling, in: Kühling/Buchner, DS-GVO/BDSG, 2. Aufl. 2018, Art. 7 DSGVO Rn. 50; Dix, ZEuP 2017, 1, 4; Schantz, NJW 2016, 1841, 1845. 28So etwa Sattler, in: Schmidt-Kessel/Grimm (Fn. 3), S. 18f. (zu Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO); noch großzügiger Schmidt-Kessel/Grimm, ZfPW 2017, 84, 91, die Art. 7 Abs. 4 DSGVO für Verträge über „Daten gegen Leistung“ letztlich nur ein Transparenzgebot entnehmen wollen. 29In diese Richtung etwa Dix, ZEuP 2017, 1, 5; Buchner (Fn. 18), S. 266 sowie – dies zugleich als „lebensfremd“ bewertend – Bräutigam, MMR 2012, 635, 636; siehe hierzu auch Metzger, AcP 216 (2016), 817, 823. 30Siehe dazu OLG Düsseldorf, MMR 2019, 741, sowie Langhanke/Schmidt-Kessel, EuCML 2015, 218, 222. 31Jung, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, EUV/AEUV, Stand: 04/2015, Art. 102 AEUV Rn. 389. 32Buchner (Fn. 18), S. 266f. 33Buchner/Petri, in: Kühling/Buchner (Fn. 27), Art. 6 DSGVO Rn. 23; siehe mit Hinweis auf § 242 BGB auch Taeger, in: Taeger/Gabel, DSGVO/BDSG, 3. Aufl. 2019, Art. 7 DSGVO Rn. 72f. 34Vgl. Albers/Veit, in: BeckOK Datenschutzrecht (Fn. 17), Art. 6 DSGVO Rn. 27; Schulz, in: Gola, DS-GVO, 2. Aufl. 2018, Art. 6 DSGVO Rn. 11. 35Siehe auch Metzger, AcP 216 (2016), 817, 823; Buchner, DuD 2010, 39, 40; Buchner (Fn. 18), S. 254f.; demgegenüber rät Taeger, BvD-News 1/2019, 32, 33, von der vorsorglichen Einholung einer Einwilligung ab. 36Angedeutet bei Radlanski, Das Konzept der Einwilligung in der datenschutzrechtlichen Realität, 2015, S. 207ff. 37Für einen Schutz der Verbraucher vor der Ausweitung vertraglicher Leistungsbeschreibungen zur Ermöglichung der Datenverarbeitung auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO auch Wendehorst/Graf von Westphalen, NJW 2016, 3745, 3747. 38Ebenso Graf von Westphalen/Wendehorst, BB 2016, 2179, 2185; Wendehorst/Graf von Westphalen, NJW 2016, 3745, 3747; Sattler, in: Schmidt-Kessel/Grimm (Fn. 3), S. 19. 39Ebenso Wendehorst/Graf von Westphalen, NJW 2016, 3745, 3746. 40Ebenso Metzger, AcP 216 (2016), 817, 831ff.; Specht, JZ 2017, 763, 765; implizit auch Schmidt-Kessel/Grimm, ZfPW 2017, 84, 102, 104. 41Dazu aus dogmatischer Sicht Riehm, in: 2. FS Canaris, 2017, S. 345, 354ff. 42Siehe auch Langhanke (Fn. 3), S. 125ff. 43Dies hält etwa Spindler, MMR 2016, 147, 150, für möglich; ebenso wohl Specht, JZ 2017, 763, 767 (jedenfalls als Nacherfüllungsanspruch). 44Dieser Zusammenhang wird angedeutet bei Specht, JZ 2017, 763, 768. 45Für einen Ausschluss der Vollstreckbarkeit immerhin Specht, JZ 2017, 763, 767. 46Siehe hierzu Riehm, in: BeckOGK BGB, Stand: 1.2.2020, § 275 Rn. 276. 47So Pohlmann, in: Schmidt-Kessel/Grimm (Fn. 3), S. 73, 82; Langhanke (Fn. 3), S. 127. 48Ebenso die h.M., vgl. Pohlmann, in: Schmidt-Kessel/Grimm (Fn. 3), S. 103. 49Aus dogmatischer Sicht ist zwischen dem klagbaren und in Natur durchsetzbaren Anspruch einerseits und der „bloßen“ Leistungspflicht als Grundlage für die Bestimmung einer Pflichtverletzung i.S.v. § 280 I BGB zu unterscheiden, vgl. eingehend Riehm (Fn. 41). 50Siehe hierzu Langhanke (Fn. 3), S. 137ff. 51Dies befürwortend Metzger, AcP 216 (2016), 817, 852f., 864. 52Ebenso Graf von Westphalen/Wendehorst, BB 2016, 2179, 2184; Schmidt-Kessel/Grimm, ZfPW 2017, 84, 103f., sowie zur Rechtslage vor der DSGVO Langhanke/Schmidt-Kessel, EuCML 2015, 218, 221f. 53Ebenso Metzger, AcP 216 (2016), 817, 825; anders noch Langhanke/Schmidt-Kessel, EuCML 2015, 218, 222; Langhanke (Fn. 3), S. 138 (jeweils zur Rechtslage vor der DSGVO). 54So Schmidt-Kessel/Grimm, ZfPW 2017, 84, 103f.; wohl auch Metzger, AcP 216 (2016), 817, 835; noch weitergehend geht Specht, JZ 2017, 763, 767, sogar nur von fehlendem Verschulden aus. 55Dazu sogleich III. 1. c). 56Insoweit ebenso Langhanke/Schmidt-Kessel, EuCML 2015, 218, 222; wohl auch Schmidt-Kessel/Grimm, ZfPW 2017, 84, 104. 57Anders offenbar Metzger, AcP 216 (2016), 817, 849f. 58Siehe dazu Langhanke (Fn. 3), S. 142ff. sowie Metzger, AcP 216 (2016), 817, 859ff. (Letzterer für eine Anwendbarkeit der mietrechtlichen Gewährleistung zulasten des Kunden). 59Siehe dazu nur Armbrüster, in: MüKo-BGB (Fn. 22), § 123 Rn. 46ff. 60Ausdrücklich a.A. Metzger, AcP 216 (2016), 817, 852f. 61A. A. wohl Metzger, AcP 216 (2016), 817, 850. 62Pohlmann, in: Schmidt-Kessel/Grimm (Fn. 3), S. 82; siehe zu dieser Funktion der Obligation näher Riehm (Fn. 41), S. 349ff. 63Insoweit a.A. Klement, in: Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann (Fn. 7), Art. 7 DSGVO Rn. 57; Taeger, BvD-News 1/2019, 32, 34. 64Ebenso Metzger, AcP 216 (2016), 817, 823; Buchner, DuD 2010, 39, 41; Buchner (Fn. 18), S. 267; skeptisch dagegen Menzel, DuD 2008, 400, 406; Zscherpe, MMR 2004, 723, 727. 65Buchner, DuD 2010, 39, 41; ähnlich Specht, JZ 2017, 763, 766; Klement, in: Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann (Fn. 7), Art. 7 DSGVO Rn. 62. 66Siehe bereits oben II. 2. 67So etwa Schmidt-Kessel/Grimm, ZfPW 2017, 84, 104; Specht, OdW 2017, 121, 123 m.w.N. 68Näher Riehm (Fn. 41), S. 356. 69Siehe oben II. 2 sowie III. 1. b). 70Schmidt-Kessel/Grimm, ZfPW 2017, 84, 104f.; de lege ferenda auch Specht, JZ 2017, 763, 769; Specht, OdW 2017, 121, 126. 71Oben III. 1. b); insoweit a.A. Specht, in: Briner/Funk, DGRI Jahrbuch 2017, 2018, S. 35 (Rn. 13). 72Oben Fn. 4. 73Ebenso Metzger, AcP 216 (2016), 817, 833. 74Magnus, MMR 2019, 542, 543; Beurskens, NJW 2018, 3418, 3420; Müller-Riemenschneider/Specht, MMR 2018, 547, 547. 75Larenz/Canaris, Lehrbuch des Schuldrechts II/2, 13. Aufl. 1994, § 68 I 3a (S. 150f.). 76Oben III. 1. b). 77Ebenso im Ansatz Langhanke/Schmidt-Kessel, EuCML 2015, 218, 222; Schmidt-Kessel/Grimm, ZfPW 2017, 84, 103; im Ergebnis auch Metzger, AcP 216 (2016), 817, 859f.; Specht, JZ 2017, 763, 768: Anwendung des § 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB. 78Oben III. 1. b). 79Zur Anwendbarkeit auf Verträge „Daten gegen Leistung“ Schmidt-Kessel/Grimm, ZfPW 2017, 84, 103. 80Die Kündigungsrechte aus § 313 und § 314 BGB bestehen nach h.M. nebeneinander, vgl. BGH, ZIP 2014, 1382 Rn. 31 ff.; Martens, in: BeckOGK BGB, Stand: 1.6.2019, § 313 Rn. 190. 81Der Telematiktarif der HUK Kfz-Versicherung enthielt z.B. folgende Klausel: „Sie und wir können diesen Vertrag außerdem aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Wichtige Gründe sind beispielsweise: Sie oder der Halter stimmen der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung des Smart Driver Programms nicht zu. Oder sie widerrufen die Einwilligung.“ (HUK24 Smart Driver Vertrag, Stand: 2018).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Festschrift für Jürgen Taeger»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Festschrift für Jürgen Taeger» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Festschrift für Jürgen Taeger» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.