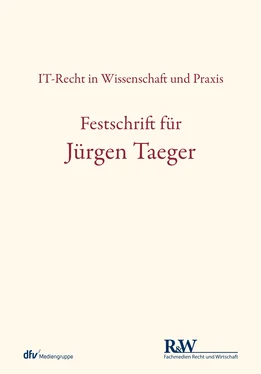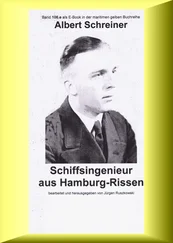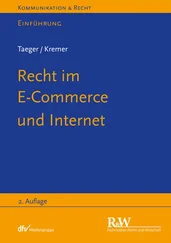Auch aus Art. 3 Abs. 1 Satz 2 der Digitale Inhalte-Richtlinie72 folgt nichts anderes: Diese Vorschrift erstreckt zwar den Anwendungsbereich der Richtlinie auf Verträge, bei denen die Gegenleistung des Verbrauchers in der Bereitstellung personenbezogener Daten besteht, sagt aber nichts über die dogmatische Einordnung dieser Verträge aus.73
Gleichwohl lässt sich nicht leugnen, dass die datenschutzrechtliche Einwilligung für viele Geschäftsmodelle geradezu unabdingbare (faktische) Voraussetzung ist. So kann etwa eine Versicherung die Prämie für einen Telematiktarif nicht kalkulieren, wenn sie keinen Zugriff auf die Fahrdaten des Kunden hat. Die Möglichkeit einer Reduktion des Versicherungstarifs ist eine Konsequenz der gesammelten Fahrdaten, indem die Risikoeinstufung des Fahrers auf deren Grundlage präzisiert werden kann. Um eine „Gegenleistung“ im rechtlichen Sinne handelt es sich dabei aber nicht. Ähnlich liegt es bei sozialen Netzwerken, soweit es um die Einwilligung in die Weiterverbreitung der nutzergenerierten Inhalte geht: Hierbei handelt es sich um die Kernaufgabe des sozialen Netzwerks als Anbieter,74 die nur erfüllt werden kann, wenn die datenschutzrechtliche Einwilligung für die Weiterverbreitung dieser Daten besteht. Auch hier ist die Generierung der Inhalte durch die Nutzer Voraussetzung, nicht Gegenleistung für deren Weiterverbreitung.
Fehlt eine derartige faktische oder wirtschaftliche Voraussetzung für die Erbringung der „Gegenleistung“ durch den Anbieter, ohne dass ein synallagmatischer Vertrag vorliegt, so kennt das BGB verschiedene andere Reaktionsmöglichkeiten jenseits der §§ 320ff. BGB, die im Folgenden auf ihre Passung für die geschilderten datengetriebenen Geschäftsmodelle zu untersuchen sind.
b) Vom Gläubiger zu vertretende Unmöglichkeit der Leistung?
Kann der Anbieter seine Leistung ohne Vorliegen einer datenschutzrechtlichen Einwilligung des Betroffenen gar nicht erbringen, ergibt sich die Auswirkung auf die Gegenleistung bereits aus § 275 Abs. 1 BGB: Deren Erbringung ist schlicht tatsächlich oder rechtlich unmöglich. Das vertragliche Schuldverhältnis wird hierdurch zwar nicht aufgelöst; der Kunde verliert aber seinen Anspruch gegen den Anbieter nach § 275 Abs. 1 BGB und ist auch selbst nach dem oben Ausgeführten nicht zur (Wieder-)Erteilung der Einwilligung verpflichtet, sodass das Schuldverhältnis faktisch keine Ansprüche mehr begründet und in der Sache erledigt ist.
Soweit der Kunde neben der Datenüberlassung auch eine monetäre Gegenleistung schuldet, erlischt diese Gegenleistungspflicht im Ausgangspunkt nach § 326 Abs. 1 BGB, wenn der Anbieter seine Leistung wegen der fehlenden Einwilligung des Nutzers nach § 275 Abs. 1 BGB nicht mehr erbringen muss. Allerdings kann der Kunde im Sinne des § 326 Abs. 2 Satz 1 BGB „allein oder weit überwiegend verantwortlich“ für die Unmöglichkeit der Leistungserbringung sein. Insoweit sind die Beweggründe des Kunden für den Widerruf der Einwilligung im Einzelnen zu untersuchen: Einerseits sollte der Kunde sich nicht allein durch den Widerruf der Einwilligung von einem Vertrag befreien können, der ihm aus anderen Gründen lästig oder zu teuer geworden ist; was für eine Anwendung des § 326 Abs. 2 Satz 1 BGB spricht. Andererseits kann es eine unzulässige Sanktion des Widerrufs der Einwilligung darstellen, wenn diese dazu führt, dass der Kunde nunmehr zwar wegen § 275 Abs. 1 BGB keine Gegenleistung mehr erhält, den Preis wegen § 326 Abs. 2 Satz 1 BGB aber weiterhin in voller Höhe bezahlen muss. Das Merkmal der „alleinigen oder weit überwiegenden Verantwortlichkeit“ bietet jedoch hinreichenden Spielraum für die Berücksichtigung dieser Umstände zur Erzielung angemessener Lösungen im Einzelfall unter Berücksichtigung der Wertungen der DSGVO.
c) Condictio ob rem (§ 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BGB)
Für vertraglich vereinbarte Leistungen, die einander synallagmatisch gegenüberstehen, ohne dass sie wirksam rechtlich vereinbart werden können, tritt die condictio ob rem (§ 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BGB) an die Stelle des allgemeinen Leistungsstörungsrechts.75 Widerruft der Betroffene seine datenschutzrechtliche Einwilligung, so kann damit der „mit der Leistung bezweckte Erfolg“ für die Gegenseite entfallen, mit der Folge, dass diese ihre bereits erbrachte Leistung zurückfordern kann. Freilich setzt dies voraus, dass die datenschutzrechtliche Einwilligung als quasi-synallagmatische Gegenleistung für die Leistung des Anbieters vereinbart wurde und dieser in Vorleistung gegangen ist. Wie soeben ausgeführt, dürfte dies in den seltensten Fällen der Fall sein.
Ein „Nachteil“ i.S.v. Erwägungsgrund 42 Satz 4 DSGVO im oben beschriebenen Sinne76 liegt darin nicht, wenn nur derjenige Teil der Leistung des Anbieters zurückgefordert wird, der tatsächlich im (vertraglich bestimmten) Synallagma zu der pro futuro erteilten und vereinbarten Einwilligung stand und dessen Zweck bei objektiver Bestimmung weggefallen ist. Die letztgenannte Frage werden die Gerichte unter besonderer Berücksichtigung des Freiwilligkeitserfordernisses der Einwilligung und des Erwägungsgrund 42 Satz 4 DSGVO streng zu prüfen haben.
d) Kündigung aus wichtigem Grund (§ 314 BGB)
Der Widerruf der Einwilligung kann im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen ferner einen wichtigen Grund für die außerordentliche Kündigung gemäß § 314 BGB darstellen.77 Das wird insbesondere dann anzunehmen sein, wenn die Möglichkeit der Verarbeitung von Nutzerdaten wesentlich für die Kalkulation der „Gegenleistung“ des Anbieters ist. Voraussetzung ist dann allerdings, dass infolge des Widerrufs der Einwilligung dem Anbieter das weitere Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann. Dies erfordert eine umfassende Interessenabwägung, in die einerseits die wirtschaftlichen Interessen des Anbieters an der Gestaltung und Refinanzierung seines Angebots und andererseits die Interessen des Nutzers am weiteren Bezug der Leistungen einzustellen sind. Grundlage hierfür ist das vertraglich vorausgesetzte Äquivalenzverhältnis von Leistung und „Gegenleistung“ (einschließlich der Einwilligung in die Datenverarbeitung). Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Kündigung des Vertrages keinen „Nachteil“ im Sinne einer Sanktion für die Ausübung des Widerrufsrechts darstellen darf.
Insofern kann an die obigen Ausführungen zur Bedingungskonstruktion78 angeknüpft werden: Wenn der Anbieter legitimerweise die Einwilligung des Nutzers in die Datenverarbeitung zur Voraussetzung des Vertragsschlusses und damit seiner Leistungserbringung machen darf, so muss es ihm auch freistehen, für die Zukunft vom Vertrag Abstand zu nehmen und seine Leistung nicht mehr zu erbringen, wenn der Betroffene diese Bedingung während der Vertragslaufzeit nicht mehr erfüllt. Daher dürfte die außerordentliche Kündigung häufig zulässig sein, soweit der Kunde durch den Widerruf der Einwilligung das Äquivalenzverhältnis für die Zukunft stört, d.h. der Anbieter für seine zukünftig zu erbringenden Leistungen nicht die vertraglich vereinbarte Gegenleistung in Gestalt der Einwilligung erhält. Anders liegt es nur, wenn der Kunde auf die Dienstleistung existenziell angewiesen ist und der marktbeherrschende Anbieter unangemessene Bedingungen stellt.
Der Unterschied zum – hier abgelehnten – Zurückbehaltungsrecht aus § 320 BGB besteht darin, dass für § 314 BGB eine Zumutbarkeitsprüfung vorzunehmen ist, die unter besonderer Berücksichtigung des Freiwilligkeitserfordernisses der Einwilligung im Lichte des Erwägungsgrund 42 Satz 4 DSGVO zu erfolgen hat. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung kein regelhafter Mechanismus ist, der den Kunden vom Widerruf seiner Einwilligung abhalten könnte, sondern sie nur dann besteht, wenn durch den Widerruf das vertragliche Äquivalenzverhältnis pro futuro so gestört ist, dass dem Anbieter das weitere Festhalten zu unveränderten Konditionen nicht mehr zumutbar ist.
Читать дальше