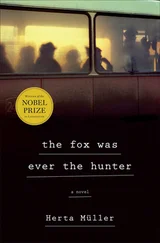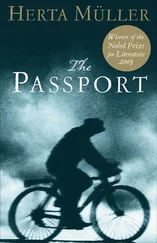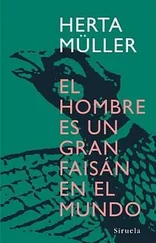Das sind jetzt aber keine wirkungsstrategischen Entscheidungen zur Gestaltung von Fremdheitseffekten, oder?
Eine meiner Erzählungen trägt den Titel »Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt«. Das ist eine aus dem Rumänischen übersetzte Redewendung, von der man im Rumänischen genau weiß, was sie bedeutet: Der Mensch ist ein Verlierer. Im Deutschen erschließt sich diese Bedeutung erst einmal nicht. Aber ich hatte in der Erzählung die Möglichkeit, die Redewendung so zu platzieren, dass der deutsche Leser ahnt, was gemeint ist. Fasane sind tapsig und finden sich nicht so gut zurecht. Die Rumänen haben dies als Ausgangspunkt für die Metapher genommen. Der Mensch ist ein Fasan, weil er sich nicht, weil er sein Leben nicht im Griff hat. Das ist der Unterschied zum deutschen Fasan, der eher ein Bild für Arroganz liefert. Darum ist mir der rumänische Fasan viel näher als der deutsche. Ich liebe den rumänischen Fasan, nicht den deutschen. So geht es mir mit vielen Wörtern. Und nicht nur mir, sondern wohl jedem, der in seinem Leben mehrere Stationen hinter sich gebracht hat, mehrere Auftenthaltspunkte, mehrere Orte in der Welt. Wenn ich ›Frankfurt‹ lese, finde ich dieses Wort jedes Mal aufs Neue großartig, denn ›Furt‹ heißt auf Rumänisch ›Diebstahl‹. Und dass nun ausgerechnet viele Banken in Frankfurt sind, das ist zwar ein Zufall, aber ein schöner Zufall. Zufall ist so schön.
Das funktioniert allerdings nur, wenn man beide Sprachen gleichermaßen beherrscht.
Ja, ich kann sie vielleicht nicht gleichermaßen, aber ich kann sie. Ich könnte nicht auf Rumänisch schreiben.
Heißt das, die 2005 in dem Band »Este sau nu este Ion« erschienenen rumänischen Collagen sind übersetzt?
Nein, dieser Band enthält Collagen, für die ich das Textmaterial ausgeschnitten habe. Ich wollte zeigen, was für eine großartige Sprache das Rumänische ist, eine Sprache, in der sich viele Wörter reimen, auch die Ironie besser funktioniert als im Deutschen. Das vermeintlich Vulgäre, die Diminutive, all das hat eine ganz andere Bedeutung als im Deutschen. Es gibt unterschiedliche ästhetische Grundsätze in den beiden Sprachen. Wenn ich auf deutsch »Kaffeechen« sage, ist das ganz etwas anderes, als wenn ich im Rumänischen »cafeluța« sage. Und so ist es auch mit dem Fluchen. Weil ich von diesen Unterschieden wusste, wollte ich zumindest einmal auch Collagen mit rumänischen Texten herstellen. Zudem besaß ich viel Material. Zwei Jahre lang arbeitete ich nur mit rumänischen Zeitschriften an rumänischen Collagen, aber dann war Schluss. In irgendeiner der Schubladen hier müssen noch viele rumänische Wörter liegen, ich werfe sie nicht weg, sie bleiben hier, sie dürfen hier sein wie die deutschen Wörter auch.
Mehrsprachigkeit ist also eine Chance für Literatur?
Ich finde, Randliteraturen sind oft so interessant, weil sie in Kontakt zu anderen Sprachen und Ländern stehen. An den Rändern geht viel durcheinander, die, die an Rändern wohnen, bekommen von all dem jenseits der Grenzen etwas mit, und all dieses Andere hat natürlich seine eigene Sicht, einen eigenen Blick.
Mich würde noch ein anderer Aspekt Ihrer Sprache interessieren, nämlich das wiederholte Aufgreifen von Redewendungen.
Also, ich finde, das Schönste an der Sprache ist die Verblüffung, ist, wenn jemand ahnungslos etwas Großartiges sagt, einen Satz, der in sich viele Bedeutungen birgt. Da horche ich richtig auf. Die sagen das nicht absichtlich, sondern es ist einfach intuitiv so. Oft versteckt sich gerade auch in Redewendungen Großartiges, jede Sprache besitzt solche Fertigteile, die nicht ideologisch sind, die einfach überliefert und gebräuchlich geworden sind. Ich frage mich, wie eine Redewendung entstanden ist? Irgendwann muss sie irgendjemand zum ersten Mal gesagt haben, und ein anderer hat sie wiederholt, weil sie sich gut eignete für eine andere Situation, und nach einiger Zeit wurde aus dem Satz eine Redewendung und eine Art Parabel, die für alles mögliche gut ist. Solche Redewendungen hab ich oft zu Hause gehört, von meinen Eltern oder von meiner Großmutter. »Denk nicht dorthin, wo du nicht sollst«, zum Beispiel. Ist das nicht ein großartiger Satz? Das ist umständlich und unbeholfen, aber gerade dadurch wird der Satz so großartig und die darin ausgesprochene Warnung klingt gar nicht mehr so böse. Der Satz ist mehr als bloß eine Drohung, die Warnung schützt dich auch irgendwie, obwohl sie dir etwas verbietet. Wenn der Satz gelautet hätte, »Denk nicht das, was du nicht denken sollst«, dann wäre aus ihm sicher keine Redewendung geworden. Oder: »Am Rand der Pfütze springt jede Katze anders«. Das sind Sätze, die mir in bestimmten Situationen halfen, in denen ich nicht mehr weiter wusste. Sie haben mich jedenfalls nie getäuscht. Und irgendwie haben sie mich auch behütet. Von solchen Redewendungen gibt es jede Menge, und oft hörst du sie von sogenannten ›einfachen‹ Menschen. Das ist die Poesie der Ahnungslosen. Ich finde Redewendungen auch so schön, weil die, die sie verwenden, oft nicht wissen, wie poetisch diese Sätze sind. Das ist Alltag, und das berührt mich ja. Davon kann ich als Schriftstellerin profitieren.
Ich würde, wenn es Ihnen recht ist, gerne das Thema wechseln, hin zum Schreiben und besonders hin zum Herstellen von Collagen. Ich möchte beginnen mit einer Frage, die die ganz unmittelbare ›Materialität‹ und vor allem auch die ›Körperlichkeit‹ des Schreibens betrifft. Welche Schreibutensilien nutzen Sie? Schreiben Sie im Stehen oder im Sitzen?
Ich habe solchen Fragen oder Problemen noch nie eine Bedeutung beigemessen. Ich habe überhaupt keine Rituale. Ich würde auch nie sagen: Das kann ich so und nur so oder nur dort oder nur dann oder nur unter bestimmten Umständen. Solche Gedanken kommen mir nicht, weil ich, als ich anfing zu schreiben, in der Not geschrieben habe. Ich habe in der Fabrik, zwischen den Etagen, auf den Treppen, geschrieben, das heißt: Mein Schreibzeug ist gewesen, was ich zur Hand hatte. Es gab in Rumänien nicht einmal Papier. Ich habe Papier aus der Fabrik genutzt, irgendwelche einseitig beschriebenen Listen oder Formularblätter, die im Büro nicht mehr gebraucht wurden. Das schenkten mir die Buchhalter. Es gab auch keine Kopiergeräte; Schreibmaschinen mussten jedes Jahr für eine Schriftprobe zur Polizei gebracht werden, und man musste erklären, warum man sie benötigt und wer alles Zugang zu ihr hat. Also, da entwickelt man keine Allüren mit dem Werkzeug oder mit der Körperhaltung. Ich schrieb in der Haltung, in der es eben in diesem Moment ging, im Stehen, im Sitzen, krumm auf der Treppe in der Fabrik, oft so, dass keiner merkte, dass ich schrieb. Zu Hause versteckte ich das Geschriebene oder gab es jemand zum Verstecken, weil ich Angst hatte. Unter solchen Umständen achtet man weder auf die Art des Papiers noch darauf, ob man das Papier mit irgendeinem Bleistift oder mit was auch sonst immer beschreibt.
Geändert hat sich nichts. Also ich schreibe, wie es gerade kommt. Wenn mir etwas einfällt, schreibe ich es mit der Hand auf, danach tippe ich es ab. Seit wir einen Computer haben, kann ich hundertmal etwas verändern, ohne dass ich Tipp-Ex oder ich weiß nicht was benutze. Aber ich denke gar nicht darüber nach. Ich habe den Eindruck, wie ich schreibe, wann und mit welchen Mitteln, ob ich morgens oder abends schreibe, das ist absolut unwichtig. Wichtig ist nur, was kommt raus, damit habe ich genug zu tun. Das ist schon schwierig genug. Damit habe ich oft Probleme, nicht aber damit, womit es geschrieben ist. Kugelschreiber beispielsweise, ich klaue Hotelkugelschreiber. Ich glaube, ich wäre zu schade für einen teuren Füllfederhalter, weil ich den nicht schätzen könnte, ich bin eine, ja, ich bin eine Banausin in diesen Dingen. Anders ist es allerdings beim Kleben, da achte ich etwa sehr auf das Papier.
Читать дальше