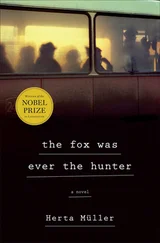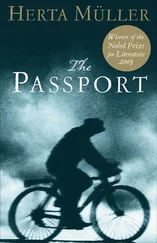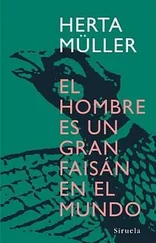Es gab in Rumänien ja auch die Kulturinstitute der DDR. Haben Sie von diesen auch Bücher ausleihen können?
Ja, die gab es, aber die waren furchtbar, die haben wir gar nicht erst betreten. Von einem Leiter des DDR-Kulturinstituts wurden wir einmal beim Geheimdienst denunziert, wegen Wolf Biermann. Dieser Mann war dabei, als wir im Adam-Müller-Guttenbrunn-Literaturkreis in Temeswar Biermann-Lieder gehört haben. Seine Anzeige führte zu Hausdurchsuchungen bei uns.
Und haben Sie außer deutschsprachiger Literatur auch Literatur aus anderen Ländern gelesen?
Natürlich lasen wir auch Bücher rumänischer Autoren. Aber oftmals fehlte uns etwas. Wir wollten wissen, wie geriet man in so eine finstere Diktatur, wie konnte ein Land so verelenden, wie kam es zu dem ungeheuren Personenkult um Ceaușescu, wie er seit Stalin nirgends mehr in Osteuropa anzutreffen war. Auf solche Fragen benötigten wir Antworten. Die fanden wir aber weniger bei rumänischen Intellektuellen, als vielmehr bei Autoren aus Ungarn, aus der ČSSR oder aus Polen. Oder wir fanden sie bei Schriftstellern aus mittel- und südamerikanischen Ländern, die ja ebenfalls oft diktatorisch regiert wurden. Rumänien hatte – wahrscheinlich weil das Rumänische auch zu den romanischen Sprachen gehört – eine enge Beziehung zu lateinamerikanischen Schriftstellern. Viele Bücher wurden sehr früh ins Rumänische übersetzt, beispielsweise die von Gabriel García Márquez – den ersten Márquez habe ich auf Rumänisch gelesen. Wir lasen auch kubanische Literatur oder die Bücher von Ernesto Cardenal. Oft wurden aus den Ländern, mit denen es politische oder wirtschaftliche Beziehungen gab, auch Bücher importiert. Mit den Filmen war es genauso. Wir schauten uns unendlich viele sowjetische Filme an, Filme, die hauptsächlich in den asiatischen Regionen der Sowjetunion produziert wurden. Das war eine unglaubliche Kinematografie, und keineswegs nur sozialistische Auftragskunst. Diese unglaublich schönen kleinen, feinen Kunstgeschichten kamen ebenso in die Kinos wie die offiziellen, indoktrinierenden blöden Staatsschinken.
Wo haben Sie sich denn über Literatur ausgetauscht? Einerseits gab es ja diesen offiziellen Adam-Müller-Guttenbrunn-Kreis, den Sie eben erwähnt haben, andererseits und jenseits dessen haben Sie sicherlich auch an anderen Orten diskutiert.
Der Adam-Müller-Guttenbrunn-Kreis war konventionell und konservativ. Dort trafen sich alte Menschen, darunter auch solche, die früher Nazi-Gedichte geschrieben hatten und jetzt stalinistische Gedichte verfassten. Ja, wir sind in diesen Literaturkreis gegangen, haben uns dort eingemischt, vielleicht kann man auch sagen, wir haben den Laden aufgemischt.
»Wir« heißt: die »Aktionsgruppe Banat«?
Auch, aber ich gehörte ja nicht zur Aktionsgruppe. Ich schrieb einmal für den Literaturkreis einen Text, der hieß »Das schwäbische Bad«, es sollte um Heimat gehen. Na gut, ich geb’s euch, habe ich mir gedacht. Wenn ihr Heimat wollt, dann bekommt ihr sie, aber so, wie ich sie sehe. Die Aufregung war groß. Aber ich war nicht die Einzige, die diese alten Menschen herausforderte. Andere haben genauso dafür gesorgt, dass die alteingesessenen Mitglieder sich übergangen und überfordert fühlten. Wir wurden natürlich auch denunziert und dann kamen die Hausdurchsuchungen, der Arrest und alles.
Und außerhalb dieses Literaturkreises?
Alle in meinem Freundeskreis haben schon sehr früh angefangen zu schreiben, auf dem Gymnasium schon, Gedichte vor allem. Wir schrieben, wir tauschten uns aus, wir diskutierten über das, was wir gelesen hatten. Aber wir teilten auch dieselben Anschauungen, wir hassten diesen Staat und diese Unterdrückung, dieses Maulhaltenmüssen, und wir teilten auch die Angst. In unserer Gruppe waren wir zu Hause, nur dort wurde offen über die unmöglichen Zustände gesprochen. Das hat uns zusammengeschweißt. Und auch, nachdem unsere Gruppe verboten worden war, blieben wir Freunde. Selbst dann, als wir nach dem Studium über das ganze Land verteilt wurden. In Rumänien war es eine allgemeine Pflicht, dass man drei Jahre nach dem Studium irgendwo in dem Beruf arbeitete, auf den hin man studiert hatte. Wo das war, entschied der Staat. Das war die beste Gelegenheit, uns so weit auseinander zu bringen, dass wir uns nur noch sehr selten sehen konnten. Ich musste in die Moldau, eine Gegend ganz im Osten, an der Grenze zu Moldawien, andere mussten im Süden arbeiten. Aber selbst in der Zeit verloren wir den Kontakt nicht. Das waren enge Freundschaften, fast als wäre man Geschwister, daran konnte die Geheimpolizei nichts ändern.
Haben sich Ihre Lektüren dann gravierend verändert, als Sie 1987 nach Deutschland gekommen sind?
Eigentlich nicht, mich hat nach meiner Ausreise nach wie vor das Thema Diktatur interessiert, nicht nur die in Rumänien, sondern auch in anderen Ländern. Was sich aber in Deutschland änderte: Ich konnte schreiben, was ich wollte, ich musste nichts mehr verstecken. Ich konnte einfach in eine Buchhandlung oder in eine Bibliothek gehen, um mir ein Buch zu besorgen. Also sind ganz andere Beziehungen zu Menschen, zu Büchern, möglich geworden und natürlich dann auch neue ästhetische Erfahrungen. Ich hatte nun auch den Wunsch nach Lektüre jenseits des notwendigen Verstehens des Lebens. Vielleicht hätte ich manches Buch früher in Rumänien nicht gelesen, was ich in Deutschland las, zum Beispiel die sehr, sehr großartigen Bücher von Per Olov Enquist, die nichts mit Diktatur zu tun haben. Ich halte ihn für einen großartigen Stilisten. Dass solche Lektüren dazu kamen, war vielleicht neu. Ich selbst habe so viel über Diktatur geschrieben oder schreiben müssen, weil ich so kaputt war und weil ich den Kopf bei gar nichts anderem hatte und weil es ja die Diktatur in Rumänien die ersten Jahre, in denen ich in Deutschland lebte, immer noch gab. Es tut weh, wenn man grauenhafte Verhältnisse selbst erlebt hat und weiß, dass andere sie immer noch erleben, und man kann eigentlich nichts für sie tun, außer man spricht und schreibt darüber. Ich fand, das sei das Mindeste, was ich tun könnte, aber selbst wenn ich diesen Grund nicht gehabt hätte, ich hätte so oder so über nichts anderes schreiben können.
Über Theodor Kramer, Bernhard oder auch Márquez haben wir gesprochen. Sind denn aus der Gegenwartsliteratur noch Bücher dazugekommen, denen Sie einen ähnlichen Stellenwert wie den Büchern der Genannten zusprechen würden?
Ja, immer wieder. Ich habe gerade »Auf Erden sind wir kurz grandios« von Ocean Vuong gelesen. Ich könnte das ganze Buch abschreiben, es ist so grandios. Als Leserin bin ich total ungeschützt. Ich lese ganz langsam und wenig und bemühe mich darum, dass das Buch noch eine Weile hält. Aber mit anderen Büchern bin ich ungeduldig, Bücher, in denen ich nichts finde. Weil ich als Leserin so ungeschützt bin, lasse ich mich auch nicht vereinnahmen. Wenn ich an einem Buch nichts finde, zwanzig, dreißig Seiten lang, dann sage ich, ist gut, ist nicht für mich, ist nicht meine Sache.
In früheren Interviews, auch in einigen Essays, haben Sie über die Gemengelage verschiedener Sprachen, Sprachstandards und -register – Deutsch, Rumänisch, Mundart, Hochdeutsch und so weiter – gesprochen, die ihrer Literatursprache den ganz charakteristischen Ton verleiht. Ist das eigentlich auch nach der langen Zeit der Entfernung von Rumänien und aus den anderen Sprachkontexten so, dass beispielsweise das Rumänische nach wie vor im Hintergrund mitschreibt?
Ja, das Rumänische ist da, oft unterschwellig. Manchmal ist mir die andere Sprache bewusst und manchmal auch nicht. Manchmal finde ich das rumänische Bild einfach besser. Der Pfirsich beispielsweise heißt im Rumänischen die »piersică«, und dadurch hat der Pfirsich bei mir ein Samtkostüm, wegen des femininen Genus des rumänischen Pfirsichs. Ich gebe auch dem im Deutschen maskulinen Pfirsich ein Kostüm und nicht etwa einen Samtanzug, einfach weil der rumänische Pfirsich schöner ist, feminin. Sprache verändert die Ästhetik, und wenn man, bewusst oder unbewusst, in mehreren Sprachen schreibt, dann kann man gar nicht mehr von einer Ästhetik sprechen, man muss das Wort in den Plural setzen, Ästhetiken oder so. Die Worte in einer bestimmten Sprache haben ja einen eigenen, ihren eigenen Blick und ihre eigene Befindlichkeit in jeder Sprache. Und oft ist mir die Befindlichkeit des rumänischen Wortes näher als die des deutschen Wortes.
Читать дальше